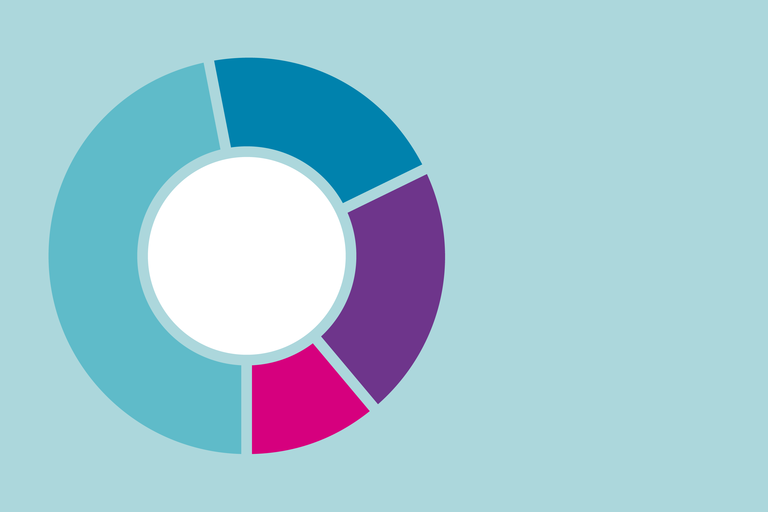: INTERVIEW 'Wettbewerb fördert die soziale Spaltung'
Bildungsökonom Manfred Weiß über erhoffte Wirkungen und ungute Nebenwirkungen des Wettbewerbs von Schulen.
Mit Prof. Manfred Weiß vom Institut für internationale pädagogische Forschung (DIPF) sprach Mario Müller./Foto: Rumpenhorst
Herr Professor Weiß, würden Sie Ihre Kinder heute noch einmal auf eine staatliche Schule schicken? Natürlich. Warum nicht?
Weil immer mehr Eltern inzwischen private Schulen bevorzugen.
Das stimmt. Umfragen deuten auf eine hohe Wechselbereitschaft hin. Viele Eltern sagen, dass sie ihre Kinder auf eine Privatschule schicken würden, wenn sie sich das finanziell leisten könnten. Dieser Trend hat vor allem durch die PISA-Studien der OECD nochmals Schubkraft erhalten. Deren Ergebnisse führten bei vielen zu einer negativen Wahrnehmung des staatlichen Schulwesens. Hinzu kommt, dass neue Privatschulen in den Medien gerne positiv dargestellt werden. Das lesen auch die Eltern.
Haben sie nicht recht?
Die vielfach behauptete Leistungsüberlegenheit privater Schulen konnten wir in unseren Auswertungen von PISA-Daten nicht nachweisen. Meines Erachtens besteht kein Grund, unser staatliches Schulwesen generell zu kritisieren und eine Fluchtbewegung jetzt auch noch zu forcieren. Wir sind mit den vielen Reformen auf einem guten Weg. Das zeigt sich unter anderem daran, dass der hoch dotierte Deutsche Schulpreis bislang fast ausnahmslos an staatliche Schulen ging, die durch pädagogische Innovationen, gute Leistungsergebnisse oder ein gutes Schulklima auffielen. Das staatliche Schulwesen ist nicht so reformresistent, wie es oft dargestellt wird.
Hat der Wettbewerb durch die privaten den staatlichen Schulen also gewissermaßen Beine gemacht?
Der Ruck, den wir dort sehen, geht auf den PISA-Schock zurück. Als Reaktion darauf wurden zahlreiche Reformen in Angriff genommen: Die frühkindlichen Fördermaßnahmen und die Ganztagsangebote wurden gezielt ausgebaut, die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt; es gibt heute regelmäßig Lernstandserhebungen, Schulinspektionen und Bildungsstandards wurden ja auch eingeführt.
Vielen Kritikern geht das nicht weit genug. Sie verlangen mehr Markt.
Gegen Wettbewerbssteuerung im Schulbereich gibt es bei uns in Deutschland traditionell starke Vorbehalte. Dagegen nutzen Länder wie etwa England und die USA schon seit Längerem Wettbewerbselemente zur Steuerung ihres Schulsystems. Dazu gehören die Schulwahlfreiheit, die Stärkung der Konkurrenz durch private Anbieter und die Finanzierung der Schulen entsprechend der jeweiligen Nachfrage. Wettbewerbselemente haben aber auch bei uns mittlerweile im Schulbereich Einzug gehalten.
Welche sind das?
So hob die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen die festen Einzugsbereiche für Grundschulen auf, wodurch die Eltern eine andere als die nächstgelegene Schule wählen können. Sachsen veröffentlicht im Internet die Porträts von Schulen. Gleiches versucht die Schuldatenbank der Zeitschrift Focus. Um den Wettbewerb zwischen Schulen anzukurbeln, wird auch verstärkt gefordert, private und staatliche Schulen finanziell gleichzustellen und - so etwa die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände - die "Konsumentensouveränität" durch Ausgabe von Bildungsgutscheinen an die Eltern zu stärken.
Was wollen die Befürworter solcher Initiativen erreichen?
Sie erwarten nachhaltige Qualitätsverbesserungen im Schulbereich. Viele meiner Fachkollegen argumentieren, dass eine Aufstockung der Finanzmittel nicht unbedingt zu mehr Qualität in der Bildung führe. Vielmehr müssten die Institutionen und Rahmenbedingungen verändert werden, die das Verhalten der Akteure im Bildungswesen beeinflussen. Ludger Wößmann vom Münchner Ifo-Institut und Mitglied im Aktionsrat Bildung argumentiert, dass von der Konkurrenz zwischen privaten und staatlichen Schulen beide profitierten - zum Nutzen des Gesamtsystems. Wettbewerb sorge dafür, dass Innovationen schneller umgesetzt würden und sich die Leistungsergebnisse nachhaltig verbesserten.
Tun sie das denn?
Ich bin skeptisch. Eine "Meta-Analyse" zweier Bildungsökonomen aus den USA hat eine Vielzahl von Arbeiten ausgewertet. Danach zeigt sich insgesamt zwar ein positiver, aber geringer Effekt von Wettbewerb auf die Leistungen von Schülern. Betrachtet man die Einzelstudien, dann ist in der Mehrzahl der Fälle kein signifikanter Zusammenhang festzustellen. Von daher müssen wir die leistungssteigernde Wirksamkeit von Wettbewerb im Schulbereich eher zurückhaltend einschätzen.
Die Schule soll auch die Sozialisation und Integration von Schülern fördern. Funktioniert das unter Wettbewerbsbedingungen?
Das ist mein Hauptkritikpunkt am Wettbewerbskonzept. Statt zur Integration in den Schulen beizutragen, fördert Wettbewerb die soziale und ethnische Spaltung - wie die empirische Forschung zeigt. Das belegen etwa die Erfahrungen aus Chile, aber auch aus Schweden, wo Anfang der 1990er Jahre freie Schulwahl eingeführt und der Privatschulsektor gestärkt wurde. Die Folge: In Schweden nahmen nicht nur die Leistungsunterschiede zwischen Schulen zu, es fand auch eine stärkere Differenzierung nach sozialer Herkunft der Schüler statt.
Nutzt also Wettbewerb nicht allen?
Nein. Nach der Wettbewerbslogik gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das passt aber nicht zur demokratischen Vorstellung von guter Bildung für alle.
Wettbewerb schadet also der Chancengleichheit?
Ja. Die Möglichkeiten, die Wettbewerb bietet, werden vor allem von den bildungsnahen Mittelschichten genutzt. Wettbewerb sorgt dafür, dass gleich gesinnte Eltern zueinanderfinden mit einer ähnlichen Vorstellung von Bildung und davon, was eine gute Schule ist. Die Konsequenzen sind ambivalent: Einerseits entstehen dadurch Wertgemeinschaften, was sich positiv auf das Schulklima auswirken kann; andererseits wird dadurch die Entstehung von "Monokulturen" begünstigt.
Was dem gesellschaftlichen Auftrag von Schule widerspricht.
So ist es. Der lautet nämlich, zum Umgang mit Pluralität - also mit unterschiedlichen sozialen Milieus und mit kultureller Verschiedenheit - durch reale Erfahrungen im Schulalltag zu befähigen. Diesen Auftrag hat das Bundesverfassungsgericht 2006 in einem richtungweisenden Urteil klar herausgestellt - bei dem es um die Schulpflicht ging.
Warum setzen viele Länder gleichwohl auf mehr Markt im Schulwesen?
Offenbar haben sie sich zu viel versprochen. Doch die erhofften Wirkungen blieben meist aus. Dafür zeigen sich umso mehr ungewollte Nebenwirkungen.
Was sind die Gründe?
Wir haben es in Schulen mit Erziehung und Lernen zu tun, mit einem Gut, an dem viele Akteure mitwirken - Lehrer, Schüler, Eltern. Diese Akteure verhalten sich aber in der Praxis häufig völlig anders, als es das Modell des Wettbewerbs vorsieht. Von daher bringt Wettbewerbssteuerung im Schulwesen erhebliche Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Das zeigen Erfahrungen aus vielen Ländern.
Was genau läuft schief?
Wenn die finanzielle Ausstattung und unter Umständen sogar die Existenz der Schulen von ihrem Leistungsergebnis abhängt, dann werden Schulen alles daransetzen, dass ihre Leistungsbilanz stimmt. Dafür müssen sie ihre pädagogische Arbeit nicht einmal verbessern. Dies können sie allein dadurch erreichen, dass sie entsprechend leistungsfähige Schüler aufnehmen. So ein Verhalten kennen wir von den Privatschulen. Aus Sicht einer einzelnen Schule mag diese Strategie rational sein, im Gesamtsystem führt dies aber nicht zu einer höheren Qualität, wie es die Apologeten des Wettbewerbs stets behaupten.
Am Beispiel der USA sehen wir: Wenn Leistungsstandards vorgegeben werden und die Nichterfüllung massiv sanktioniert und bestraft wird, besteht die Gefahr von Manipulationen bis hin zum Betrug.
Die Bandbreite unerwünschter Reaktionen reicht vom sogenannten "Teaching to the Test" bis hin zu Manipulationen. Um gut abzuschneiden, bereiten Schulen ihre Schüler auf Tests vor oder korrigieren gar falsche Antworten. Auch zeigt sich, dass nicht testrelevante Fächer und Inhalte einen Bedeutungsverlust erfahren. Das schadet der Bildung. Aus England sind Fälle bekannt, dass schwache Schüler an Testtagen vom Unterricht ausgeschlossen wurden. In meiner Zunft werden solche Verhaltensreaktionen auf Outputvorgaben und gekoppelt mit Sanktionen bisweilen beschönigend als "strategisches Verhalten" bezeichnet.
Ist die Bundesrepublik mit der Einführung von Leistungsstandards also auf dem Holzweg?
Natürlich nicht; deren Einführung war längst überfällig. Entscheidend ist, welche Funktion die Standards im Rahmen einer outputorientierten Steuerung im Schulbereich spielen. Bei uns bilden sie nicht die Basis eines Wettbewerbskonzepts, das - wie etwa in den USA - zum Ziel hat, Schulen abzustrafen, die Leistungsprobleme haben. Allerdings werden auch wir genau hinsehen müssen, welche ungewollten Nebenwirkungen in den Schulen möglicherweise auftreten. Vom Bundesbildungsministerium wird dazu ein Forschungsprojekt gefördert.
Wie reagieren Eltern auf Wettbewerb?
Allein schon die Möglichkeit, wählen zu können, macht die Eltern zufriedener. Das ist ein positiver Effekt von Wettbewerb. Faktisch wird aber von den Wahlmöglichkeiten relativ wenig Gebrauch gemacht. Die meisten Eltern schicken ihre Kinder auf die Schule, die nahe am Wohnort liegt. Die Wahlmöglichkeiten zwischen öffentlichen und privaten Schulen nutzen vor allem die bildungsbeflissenen Eltern.
Kann deren Nachfragemacht Probleme aufwerfen?
In England sahen sich Lehrer von Gesamtschulen gezwungen, gegen ihre eigene pädagogische Überzeugung zu handeln. Weil Mittelschichts-Eltern Druck ausübten, wurden dort die Schüler wieder in Leistungsgruppen eingeteilt, obwohl das fundamental gegen das Konzept der Gesamtschule verstößt.
In der Wettbewerbslogik ist es ja so, dass die Nachfrage der Eltern das Angebot bestimmt.
Oder umgekehrt. Auch das lehrt uns das englische Beispiel. Dort findet der Wettbewerb vor allem auf der Nachfragerseite statt. Viele begehrte Schulen sind hoffnungslos überlaufen. Deshalb mussten in zahlreichen Schuldistrikten Behörden eingerichtet werden, die die Schüler auf andere Schulen verteilen. In Brighton entschlossen sich die Verantwortlichen sogar, das Los bei der Zuweisung entscheiden zu lassen, um eine größere Ausgewogenheit der sozialen Zusammensetzung an den Schulen zu erreichen. Diese Maßnahme stieß auf den erbitterten Widerstand jener bessergestellten Eltern, die ihren Wohnsitz gezielt in die Nähe von prominenten Schulen gelegt hatten und nun befürchten mussten, nicht zum Zuge zu kommen. Wir sehen also: Mehr Markt heißt oft auch mehr Bürokratie, wenn es darum geht, unerwünschte Wettbewerbsergebnisse zu vermeiden bzw. nachträglich zu korrigieren.
Warum wird das Wettbewerbskonzept nicht zurückgefahren, wenn es offensichtlich nur eingeschränkt bildungstauglich ist?
Das geschieht zum Teil schon. In England, wo Wettbewerb im Schulbereich bereits 1988 durch die Regierung Thatcher eingeführt wurde, deutet sich seit einiger Zeit eine partielle Abkehr vom Marktmodell an. Dort wurden Programme aufgelegt, die stattdessen auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Schulen setzen, wobei erfolgreiche Schulen ihre Erfahrungen an andere Schulen weitergeben sollen.
Gleichwohl scheint sich Konkurrenz unter Schulen nicht aufhalten zu lassen, schon wegen der sinkenden Schülerzahlen.
Ja, sinkende Schülerzahlen sorgen vielerorts für eine "natürliche" Konkurrenzsituation zwischen Schulen. Dieser Prozess kann nicht der Beliebigkeit des Marktes ausgesetzt werden, wie wir das gerade in den neuen Bundesländern erleben. Dort sind vielfach private, insbesondere kirchliche Träger aktiv geworden, weil es der Staat nicht schaffte, seinem Infrastrukturauftrag gerecht zu werden und kleine öffentliche Grundschulen am Leben zu erhalten.
Wird der Wettbewerbsdruck sich auch für die Sekundarschulen erhöhen?
Ja. Wir in Deutschland haben mit unserem gegliederten Schulsystem sowieso schon ein hohes Maß an hierarchischer Differenzierung. Das sollte jeder bedenken, der hierzulande den Wettbewerbsdruck auf die Schulen erhöhen will, weil zusätzliche Wettbewerbselemente die Leistungsunterschiede zwischen den Schulformen und damit die Benachteiligung von Hauptschülern weiter verstärken würden. Aus PISA hätten wir dann nichts gelernt.
ZUR PERSON
Manfred Weiß, 67, ist ein bekannter Bildungsökonom. Am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt beschäftigt sich der Wirtschaftswissenschaftler seit den 70er Jahren mit der Steuerung und der Finanzierung des Bildungswesens - im internationalen Vergleich. So hat er zum Beispiel als Mitglied des ersten PISA-Konsortiums die Leistungen der Schüler staatlicher und privater Schulen verglichen.