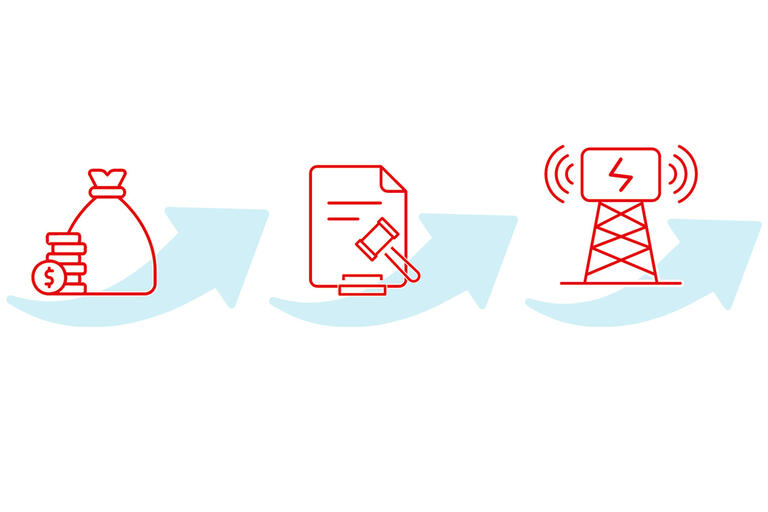: Geschichte der Mitbestimmung: 1848-1916. Wie die Gewerkschaften zur Mitbestimmung kamen
SERIE Teil 1 einer neuen Serie in drei Folgen zur Geschichte der Mitbestimmung in Deutschland über 150 Jahre Sozialgeschichte und die wichtigsten Etappen auf dem Weg zur modernen Unternehmensverfassung.
Von WALTHER MÜLLER-JENTSCH. Der Autor war bis 2001 Professor für Soziologie am Lehrstuhl Mitbestimmung und Organisation der Ruhr-Universität Bochum.
Der Ökonom Wolfgang Franz, Mitglied des Rates der Wirtschaftsweisen, hat kürzlich einen ganz eigenen Vorschlag in die Diskussion zur Reform der Mitbestimmung eingebracht. Vor dem Kronberger Kreis, einem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, plädierte er dafür, die Mitbestimmung nicht mehr gesetzlich, sondern auf freiwilliger Grundlage zu regeln - durch Verhandlungen zwischen Kapitaleignern und Arbeitnehmern.
Folgte man ihm, gäbe es am Ende wohl nur einige Oasen in einer ansonsten mitbestimmungsfreien Wüste. Denn die Geschichte und das machtpolitische Kalkül lehren uns, dass Unternehmer ihre Verfügungsrechte nach Möglichkeit ungeteilt wahrnehmen wollen.Wer aber daraus schließen will, die Mitbestimmung sei von vornherein ein originäres Ziel der Gewerkschaften gewesen - wie die Koalitionsfreiheit, das Streikrecht oder der Tarifvertrag -, der irrt.
Der sozialistischen und marxistisch orientierten Arbeiterbewegung war die Forderung nach Mitbestimmung fremd; denn mit ihr wurde ja das private Unternehmertum akzeptiert, dessen Beseitigung sich die Sozialisten zum Ziel gesetzt hatten. Zudem wurde aus der Sicht der Arbeiterbewegung der Gedanke der Klassenkooperation bis hin zur vertrauensvollen Zusammenarbeit überdehnt.
Der Soziologe Otto Neuloh, Begründer der deutschen Sektion der internationalen Gesellschaft für industrielle Beziehungen, kam der Wahrheit näher, als er 1956 in einem Buch über die deutsche Betriebsverfassung erklärte, die Mitbestimmung sei aus drei "Handlungslinien" hervorgegangen: der "Angebotslinie der Unternehmer", der "Forderungslinie der Arbeiterbewegung" und der "Gesetzgebungslinie". Es gab keinen Masterplan - erst im Mit- und Gegeneinander der drei Akteure entwickelte sich die Mitbestimmung zu einem spezifischen Modell der Arbeitnehmervertretung, das seine tieferen Wurzeln in den christlichen und sozialreformerischen Zeitströmungen des 19. Jahrhunderts hatte.
AM ANFANG WAR DIE FABRIK_ Als nach 1850 die industrielle Produktionsweise auch in Deutschland Einzug hielt, brachte sie mit der Fabrik eine neue, für den frühen Kapitalismus charakteristische Produktionsstätte hervor, die eine Vielzahl von Arbeitskräften an einem Ort unter einem Kommando zusammenfasste. Damit stellte sich das Problem, wie in dieser Ordnung die Arbeiter vertreten werden sollten. Wer sprach für sie? Sollten sie überhaupt eine eigenständige Stimme haben? Mit solchen Fragen taten sich anfänglich Unternehmer ebenso wie die entstehende Arbeiterbewegung sehr schwer.
Zwar richteten viele größere Gewerbebetriebe Unterstützungskassen für Notfälle ein, deren Vorstände von Arbeitern gebildet wurden. Aus ihnen gingen, besonders nach der Reichsgründung 1871, freiwillige Arbeiterausschüsse hervor, die unter Leitung der Betriebsführung über Fragen der Fabrikordnung berieten und bei Streitigkeiten schlichteten - meist zwischen den Arbeitern, seltener zwischen Arbeitern und Vorgesetzten. Doch blieben die Rechte dieser Gremien eng beschränkt; Akkord- und Lohnfragen wurden in der Regel ebenso wenig erörtert wie Arbeitszeitfragen. In den meisten Fabriken war der der Eigentümer der Alleinherrscher.
Vereinzelt gab es jedoch liberale Unternehmer, die sich einer sozialen Wirtschaftsverfassung verpflichtet fühlten; zu ihrer betrieblichen Sozialpolitik gehörte auch der Arbeiterausschuss als ein gewähltes Organ der Fabrikarbeiter, das mehr als dekorative Rechte besaß. Der Berliner Jalousienfabrikant Heinrich Freese, Mitbegründer der Gesellschaft für Soziale Reform, war einer von diesen aufgeklärten Geistern. Weil eine einseitige Fabrikordnung aus seiner Sicht den liberalen Ideen von Gleichheit und Gerechtigkeit widersprach, richtete er bereits 1884 einen Arbeiterausschuss ein, dessen Mitglieder aus den Reihen der Arbeiter und Fabrikbeamten gewählt wurden.
Zu dessen Befugnissen gehörte die freie Vereinbarung mit der Geschäftsleitung über die Fabrik- und Arbeitsordnung. Dass Freese überdies eine Gewinnbeteiligung der Arbeiter und bereits 1907 den Achtstundentag einführte, dokumentiert die Ernsthaftigkeit seiner Gesinnung. Freilich fand seine "konstitutionelle Fabrik" kaum Nachahmer.
DER STAAT MISCHT SICH EIN_ Es waren manifeste Revolutions- oder Streikdrohungen wie der Aufstand der schlesischen Weber von 1844, der nationale Buchdruckerstreik von 1848 und die großen Streiks der Textil- und Bergarbeiter um die Jahrhundertwende, die den Staat auf den Plan riefen, um zwischen den Klassenfronten mit einer "versöhnenden Arbeiterpolitik" zu vermitteln. Auf diese Weise wurde er zum Geburtshelfer der Mitbestimmung, die jedoch einer anderen Logik gehorchte als die Forderungen der klassenkämpferischen Gewerkschaften und der Arbeiterparteien.
Bereits während der deutschen Revolution von 1848, als erstmals ein gesamtdeutsches Parlament in der Frankfurter Paulskirche tagte, befasste sich dieses auch mit einem Gesetzentwurf für eine Fabrikordnung; er gilt heute als erste staatliche Mitbestimmungsinitiative. Den Entwurf, der Bestandteil der Reichsgewerbeordnung war, hatte ein 30-köpfiger volkswirtschaftlicher Ausschuss ausgearbeitet, dem bekannte Nationalökonomen, Staatswissenschaftler, Vertreter der gewerblichen Wirtschaft und der staatlichen Bürokratie angehörten.
Arbeiter und Handwerker fehlten - doch die bürgerliche Intelligenz war mit einem ernsthaften Reformwillen zur Einschränkung des ungehemmten Marktliberalismus und zur Lösung der Arbeiterfrage angetreten. Der Text, der von einer Abgeordnetengruppe um den sächsischen Textilfabrikanten Carl Degenkolb eingebracht wurde, enthielt ein umfassendes System betrieblicher und überbetrieblicher Mitbestimmung.
Die unterste Stufe sollte ein Fabrikausschuss bilden, der sich paritätisch aus Fabrikarbeitern und Werkmeistern (ein Vertreter aus jeder Abteilung, beide gewählt von den Arbeitnehmern) sowie dem Inhaber der Fabrik bzw. seinem Stellvertreter zusammensetzte. Zu seinen Funktionen gehörte es, bei Streitigkeiten zu schlichten, eine Fabrikordnung zu erarbeiten und die Krankenunterstützungskasse zu verwalten.
Von den Fabrikausschüssen gewählte Fabrikräte bildeten die nächste Stufe auf regionaler Ebene - die Gewerbebezirke. Für die höheren Ebenen waren Kreisgewerbekammern für die Gewerbekreise und Zentralgewerbekammern für die Einzelstaaten vorgesehen; in ihnen sollten sowohl die Fabrikräte wie auch die Handwerksräte vertreten sein. Im Geiste der Zusammenarbeit sollten die Fabrikausschüsse "die Industriegewerbe fördern und zugleich die Rechte der Arbeitnehmer wahrnehmen".
So sah es der Entwurf einer Fabrik-Gewerbe-Ordnung vor, die Carl Degenkolb dem Volkswirtschaftlichen Ausschuss vorgelegt hatte. Streitigkeiten, die innerbetrieblich nicht gelöst werden konnten, sollten durch Fabrikschiedsgerichte beigelegt werden. Leider blieben die Pläne Papier. Sie waren so kurzlebig wie die Revolution, die von der 1850 einsetzenden Reaktion erstickt wurde.
REGULIERUNG IM BERGBAU_ Ein halbes Jahrhundert später wurden im Bergbau erstmals Beteiligungsrechte gesetzlich verankert. Eine Intervention des Staates war notwendig geworden, um unversöhnliche Konfliktkonstellationen zwischen Kapital und Arbeit aufzulösen. Denn es kam wie in fast allen europäischen Industrierevieren zunehmend zu Spannungen.
Unter quasi-feudalen Verhältnissen hatten die Grubenbarone und Stahlpatriarchen an der Ruhr eine spezifische Unternehmermentalität für die Führung der in Großbetrieben zusammengeballten Massen entwickelt. Was das Vorbild war, hatte der Saarindustrielle Carl Ferdinand Freiherr von Stumm deutlich formuliert: "Wenn ein Fabrikunternehmen gedeihen soll, so muss es militärisch, nicht parlamentarisch organisiert sein."
Der daraus entlehnte autokratische Führungsstil wurde durch eine patriarchalische Sozialpolitik temperiert. Dem unbedingten, erstmals von Friedrich Krupp formulierten Herr-im-Hause-Standpunkt der Bergassessoren, Hütten- und Grubendirektoren standen umfangreiche betriebliche Sozialeinrichtungen wie Kranken-, Sterbe- und Unterstützungskassen, Werks-Konsumanstalten oder Wohnheime gegenüber, die dazu dienen sollten, "Werkstreue", so ein beliebter Begriff der Industriellen, zu erzeugen und jeden Versuch kollektiver Interessenvertretung oder gewerkschaftlicher Organisation zu unterbinden.
Entschieden wandten sich die Eigentümer gegen jede Einmischung - sei es von Regierungsstellen, Parteien oder Gewerkschaften, sei es von Kirchen oder Sozialreformern. Unter dem scharfen antigewerkschaftlichen Kurs der Bergbauunternehmer eskalierten in den Jahren 1889 und 1905 zwei revierweite Streiks zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Am Streik von 1889 beteiligten sich nahezu alle Bergarbeiter des Ruhrgebiets, rund 90000 Personen, ohne dass es einen zentralen Streikaufruf gegeben hatte.
Die militärische Intervention folgte auf dem Fuße und hatte bereits in der ersten Streikwoche elf Tote und zwei Dutzend Verwundete als Opfer zu verzeichnen. Obwohl Kaiser Wilhelm II. gegen Bismarcks Rat persönlich in die Auseinandersetzung eingriff und vor den beiden Delegationen der Arbeiter und der Unternehmer Verständnis für die Arbeiter gezeigt hatte, lehnten die Unternehmer weiterhin eine von den Arbeitern gewählte Vertretung entschieden ab.
Die preußische Staatsverwaltung stellte daraufhin intensive Überlegungen zum Abbau sozialer Spannungen an. Ihre Erkenntnis, dass es an geeigneten Vermittlungsinstanzen für die Beschwerden der Arbeiter fehle, konnte sie den Industriellen jedoch nicht vermitteln. Der Ministerialbürokratie blieb allein der Weg, die Pazifizierung mit administrativen und gesetzlichen Maßnahmen zu verfolgen. So wurde im Jahr 1905 die Einrichtung von Arbeiterausschüssen im preußischen Kohlenrevier gegen erbitterten Widerstand der Zechenbesitzer gesetzlich geregelt, nachdem diese eine Empfehlung der Berggesetznovelle von 1892, freiwillige Arbeiterausschüsse einzurichten, ignoriert hatten.
VERHÄRTETE FRONTEN_ Die Fabrikanten waren von Beschneidungen ihrer Autorität wenig begeistert. Als Nationalökonomen wie die als "Kathedersozialisten" bezeichneten Lujo Brentano, Adolph Wagner und Gustav Schmoller 1890 auf einer Tagung des Vereins für Sozialpolitik die Einführung obligatorischer Arbeiterausschüsse gefordert hatten, waren sie auf eine breite Ablehnungsfront gestoßen.
Henri Axel Bueck, der Geschäftsführer des Centralverbandes deutscher Industrieller, hielt jedwede Zwischeninstanz zwischen Arbeitgeber und Arbeiter - ob Arbeiterausschuss oder Gewerkschaft - für ein Übel. In seinem Korreferat auf der Tagung geißelte er diejenigen, die den Arbeitern "eine Gleichberechtigung und ein Selbstbestimmungsrecht in Aussicht stellen, welches absolut nicht mit unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung vereinbar ist".
Die Fronten waren verhärtet. Während die Befürworter von Arbeiterausschüssen damit argumentierten, dass als Alternative eine Revolution drohe und man den Sozialdemokraten den Wind aus den Segeln nehmen müsse, sahen deren Gegner in der Einrichtung von Arbeiterausschüssen eine Anerkennung des Interessengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit, dem die Sozialdemokratie ihre Existenz verdanke.
Dass die Gewerkschaften Einrichtungen ablehnten, die geschaffen wurden, um Bestrebungen nach gewerkschaftlicher Organisation zu konterkarieren, dürfte nicht erstaunen. Noch prinzipieller lehnte die Sozialdemokratie die nach ihrer Ansicht zur Eindämmung "sozialdemokratischer Umtriebe", so ein verbreitetes Stereotyp der Konservativen, ins Leben gerufenen Fabrik- und Arbeiterausschüsse ab. Der Sozialdemokrat August Bebel erklärte anlässlich ihrer Einführung im Reichstag, diese seien nicht mehr als ein "scheinkonstitutionelles Feigenblatt".
IGNORIERTE GEWErKSCHAFTEN_ Da die Vertreter der Groß- und Schwerindustrie die Gewerkschaften nicht als Verhandlungspartner anerkennen wollten, blieben diese praktisch bis zur Novemberrevolution von 1918/19 ohne Repräsentanz in den Betrieben - ein Problem, das der Deutsche Metallarbeiterverband zu lösen versuchte, indem er ein Vertrauensmännersystem aufbaute.
Andere Gewerkschaften folgten seinem Beispiel. Bei den Wahlen zu den Arbeiterausschüssen im Bergbau, die zunächst boykottiert worden waren, änderte der freigewerkschaftliche Bergarbeiterverband, der 1889 nach dem großen Streik gegründet worden war, seine ablehnende Haltung, nachdem die christliche Gewerkschaft beachtliche Erfolge errungen hatte, und beteiligte sich an den nachfolgenden Wahlen. Durch diese Hintertür - das hatten die Ruhrindustriellen in ihrer Angst vor sozialdemokratischer Subversion richtig gewittert - gelang es den Gewerkschaften schließlich, über die Arbeiterausschüsse Einfluss auf die betrieblichen Belange zu nehmen.
Eine Wende brachte der Erste Weltkrieg. Die Burgfriedenspolitik des Wilhelminischen Staates gegenüber der Arbeiterschaft und den Gewerkschaften führte zur Verabschiedung des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst von 1916. Es sah vor, Arbeiterausschüsse in allen Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten einzurichten. Wenn diese auch nur Beratungs- und Anhörungsrechte hatten, konnten sie im Konfliktfall doch einen paritätischen, mit einem neutralen Vorsitzenden besetzten Schlichtungsausschuss anrufen, dessen Spruch der Unternehmer sich unterwerfen musste.
Die mit dem Gesetz vollzogene Anerkennung der Gewerkschaften und vorgeschriebene Einrichtung von Arbeiterausschüssen feierte die Gewerkschaftspresse als "stärkste kriegssozialistische Maßnahme" (Zentralorgan der Freien Gewerkschaften) und als "einen ungeheuren Fortschritt" (Zeitung des Metallarbeiterverbands) auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer Reformvorstellungen. Mitten im Krieg wurden die Grundlagen einer spezifisch deutschen Konfliktpartnerschaft zwischen Kapital und Arbeit gelegt.
Der Arbeiterradikalismus gebar etwas grundlegend anderes, als seine Protagonisten gewollt hatten: nicht die Beseitigung von Unternehmermacht durch Revolution, sondern deren Begrenzung durch Partizipation. Die den Gewerkschaften aus dem Geist einer "versöhnenden Arbeiterpolitik" offerierte Institution der Mitbestimmung wurde fortan zu einem Bestandteil ihrer Programmatik und Praxis.