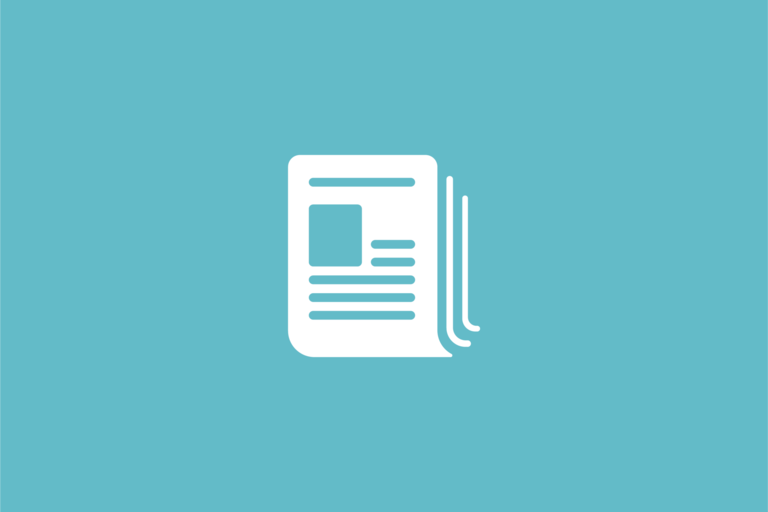: 7,50 Euro ohne Folgen?
Die gewerkschaftliche Forderung nach einem einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn spaltet die Politik und die Ökonomenzunft. Doch die Frage, ob die Wirtschaft einen Mindestlohn verträgt, kann man nicht abstrakt beantworten. Es kommt auf die Höhe an.
Von Lothar Funk
Dr. Lothar Funk ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der Fachhochschule Düsseldorf. lothar.funk@fh-duesseldorf.de
Standardmäßig dienten in der ökonomischen Debatte lange Zeit die Ergebnisse des Lehrbuchmodells der vollkommenen Konkurrenz am Arbeitsmarkt als Basis der wirtschaftspolitischen Ablehnung von bindenden Mindestlöhnen durch Ökonomen. Hiernach ist ein gesetzlicher Mindestlohn nicht relevant, wenn er unter dem so genannten Gleichgewichtslohn liegt.
Umgekehrt verursacht er negative Beschäftigungswirkungen, sobald er darüber liegt, da dann die angebotene Menge an Arbeit höher und das nachgefragte Volumen an Arbeit niedriger liegt. Das Risiko eines negativen Arbeitsmarkteffektes ist demnach dort am größten, wo die eingesetzte Arbeit eine nur vergleichsweise niedrige Wertschöpfung erzielt, also bei den Hauptproblemgruppen des Arbeitsmarktes in Deutschland: den Gering- und Fehlqualifizierten.
Mindestlohnbefürworter halten dem aktuelle Befunde entgegen, wonach die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen weder aus theoretischer noch aus empirischer Sicht so eindeutig sind, wie im wettbewerblichen Standardansatz der Ökonomen behauptet. Denn neuere Analysen zeigen, dass Arbeitslosigkeit als Folge verbindlicher Mindestlöhne nicht so häufig sein dürfte, wie bislang vermutet. Zudem sind gesetzliche Mindestlöhne im Ausland in der Tat weit verbreitet, beispielsweise in 18 der 25 EU-Staaten sowie in den USA - ohne dass hierauf direkt zurückführbare negative Beschäftigungswirkungen erkennbar sind.
Die Theorie lässt positive Effekte zu
Zunächst zur Theorie: Hier lässt sich neben dem so genannten Monopsonargument insbesondere auf such- und effizienzlohntheoretische bzw. humankapitaltheoretische Aspekte verweisen, die dem Standardmodell widersprechen.
* Im Fall des Monopsons ist ein Arbeitgeber alleiniger Nachfrager nach Arbeit auf einem lokalen Arbeitsmarkt oder kann auf segmentierten und intransparenten, "ausgedünnten" Teilarbeitsmärkten eine gewisse Marktmacht entwickeln. Er kann dann bei freier Lohnbildung die Arbeitnehmer geringer entlohnen, als es ihrem Wertschöpfungsbeitrag (gemessen am Referenzfall vollständiger Konkurrenz) entspricht. Ein Mindestlohn in Höhe des Lohnes bei vollständiger Konkurrenz bewirkt in diesem Fall nicht nur steigende Löhne, sondern auch einen Anstieg der Beschäftigung. Übersteigt der Mindestlohn aber diese Grenze, so sinkt die Beschäftigung wieder.
* Die Arbeitsmarktbeteiligung und die Suchintensität der Arbeitskräfte werden nicht nur durch die Lohnhöhe, sondern auch durch die Lohnstruktur bestimmt. Eine mindestlohnbedingt geringere Spreizung der Lohnstruktur nach unten erhöht aus Sicht des Arbeitsanbieters den Wert der Suche. Suchintensität und Annahmewahrscheinlichkeit eines Arbeitsplatzangebotes nehmen zu. Zwar verringert sich die Zahl von Arbeitsplätzen im vom Mindestlohn betroffenen Sektor. Per Saldo können jedoch die positiven Wirkungen einer intensiveren Arbeitsplatzsuche die negativen Effekte überwiegen, wenn der Mindestlohn gering ist.
* Als Folge der Einführung eines bindenden Mindestlohnes kann die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer zu- und die Fluktuationsrate abnehmen, weil die Arbeitnehmer sich nun "fair" bezahlt fühlen. Die Qualifizierungsanreize können als Folge für bestimmte Gruppen und aus Arbeitgebersicht ebenfalls steigen. Wenn die Produktivität der Arbeitnehmer in der Folge genügend steigt, kann der resultierende positive Beschäftigungseffekt den negativen Einfluss wegen der gestiegenen Arbeitskosten überkompensieren.
Grundsätzlich gilt: Die positiven Beschäftigungswirkungen einer Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes können die negativen Effekte übertreffen. Ein sehr hoch angesetzter Mindestlohn wird sich jedoch tendenziell negativ auf die Beschäftigung einzelner Bereiche auswirken, etwa weil die Produktion rationalisiert oder in das Ausland verlagert wird, soweit dieser Effekt nicht durch andere überlagert wird - beispielsweise durch eine positive Konjunkturentwicklung.
Negative Effekte sind im Ausland bislang nicht nachweisbar
Als Paradebeispiele der Mindestlohnbefürworter gelten aktuell vor allem Irland und Großbritannien. In diesen beiden Ländern sind Ende der 90er Jahre gesetzliche Mindestlöhne eingeführt worden, die in den Folgejahren zum Teil kräftig angehoben wurden. Dennoch ist die Arbeitslosenquote dort gesunken.
Der gesetzliche Mindestlohn stieg etwa in Großbritannien zwischen 1999 und 2005 nominal um 40 Prozent, während parallel die Arbeitslosenquote um 25 Prozent gesunken ist. Aber auch statistische Querschnittsuntersuchungen, die viele Vergleichsländer umfassen, und Studien auf der Grundlage von Mikrodaten finden keine eindeutigen Hinweise dafür, dass gesetzliche Mindestlöhne negative Beschäftigungswirkungen haben.
Hieraus lässt sich aber nicht ableiten, dass die Einführung eines bundesweiten Mindestlohnes von 7,50 Euro pro Stunde keine fühlbaren negativen Beschäftigungseffekte haben könnte. So wurden die Mindestlöhne in Irland und Großbritannien in einem dynamischen gesamtwirtschaftlichen Umfeld eingeführt.
Dadurch induzierte negative Effekte auf die Beschäftigung im unteren Lohnbereich (etwa wegen fehlender Preisüberwälzungsmöglichkeiten) wurden tendenziell durch die positiven Arbeitsmarktwirkungen des Wirtschaftswachstums oder durch angestoßene Produktivitätseffekte (zum Beispiel durch gesteigerte Motivation), die die Lohnstückkosten trotz des höheren Mindestlohnes stabilisierten, überkompensiert.
Für Großbritannien zeigen verschiedene Studien, dass vor allem kleine und mittlere Firmen keine Preisüberwälzungsspielräume hatten, sich im Dienstleistungssektor aber positive Produktivitätseffekte ergaben, die den Kostenanstieg jedoch nur teilweise ausglichen. Entsprechend zeigt sich ein Rückgang der Unternehmensgewinne, der bislang noch nicht zu einer größeren Insolvenzwelle geführt hat.
Man muss aber abwarten, wie sich die Mindestlöhne im Abschwung auf dem Arbeitsmarkt auswirken werden. Der entscheidende empirische Test steht demnach noch aus, selbst wenn derzeit aktuelle Fallstudien zu den angelsächsischen Ländern unzweifelhaft negative Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen nicht nachweisen.
Dass höher als in den angelsächsischen Ländern angesetzte gesetzliche Mindestlöhne sehr wohl negative Beschäftigungseffekte haben können, zeigt hingegen das Beispiel Frankreich, dessen Arbeitsmarktbedingungen etwa in Bezug auf den Regulierungsgrad und die hohe Abgabenlast den deutschen bedeutend näher kommen. Dort zeigten sich mit einer deutlichen Anhebung von Mindestlöhnen empirisch robuste, eindeutig hierauf rückführbare Beschäftigungsverluste.
Im Osten Deutschlands würden 20 Prozent der Löhne steigen
Für die Beschäftigungswirkungen von verbindlichen Mindestlöhnen ist demnach vor allem entscheidend, wie hoch diese Lohnuntergrenze angesetzt wird. Da sich die wirtschaftlichen Bedingungen von Land zu Land unterscheiden, ist die absolute Höhe der Mindestlöhne im Vergleich allerdings wenig aussagekräftig. In der EU schwanken die Mindestlöhne laut Eurostat 2006 beispielsweise zwischen 82 und 1503 Euro.
Es ist deshalb üblich, auf den so genannten Kaitz-Index abzustellen, also auf das Verhältnis zwischen Mindestlohn und Durchschnitts- oder Medianeinkommen. Zieht man die Höhe des relativen Mindestlohns heran, zeigt sich brutto eine Spanne von 32 Prozent in den USA über 42 Prozent im Vereinigten Königreich bis zu knapp 57 Prozent in Frankreich. Entsprechend unterschiedlich fällt auch die Zahl der Mindestlohnbezieher aus.
In den USA liegt der Anteil der Mindestlohnbezieher bei nur 1,4 Prozent, auf der britischen Insel bei etwa 5 Prozent, in Frankreich hingegen bei 13 Prozent der abhängig Beschäftigten. In Deutschland würde ein Mindestlohn von 7,50 Euro je Stunde nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bei rund zehn Prozent aller Beschäftigten Lohnanhebungen notwendig machen, in Ostdeutschland sogar bei 20 Prozent.
Während die beiden angelsächsischen Volkswirtschaften diese Niveaus mit einem hohen Beschäftigungsstand und einer geringen Arbeitslosenquote verbinden können, gilt dies für Frankreich nicht. Der französische Arbeitsmarkt leidet vor allem unter einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. Anders als in Großbritannien, wo für Jugendliche unter 22 Jahren abgesenkte Mindestlohnsätze gelten, greift der relativ hohe Mindestlohn in Frankreich schon ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.
Dass sich empirisch dennoch kein klarer Zusammenhang zwischen Mindestlohn- und Jugendarbeitslosigkeitsentwicklung zeigt, hängt mit den staatlich gewährten Lohnsubventionen für Mindestlohnbezieher und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Jugendliche zusammen. So zahlen Unternehmen, die Mindestlohnbezieher einstellen, weniger Sozialabgaben. Zum anderen haben die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Jugendliche zwischen 1997 und 2001 zu insgesamt 200 000 Jobs für Jugendliche im öffentlichen Sektor geführt.
Gesamtwirtschaftliche Studien zeigen hierbei eindeutig, dass die durch die erhöhten Mindestlöhne ausgelösten Arbeitsplatzverluste bei Geringqualifizierten und Jugendlichen nicht durch die positiven Beschäftigungseffekte einer Subventionierung der Arbeitskosten der Unternehmen kompensiert werden. Per Saldo bewirkten die Mindestlöhne folglich Beschäftigungsverluste in Frankreich.
Aus den derzeit verfügbaren Informationen lässt sich der folgende vorsichtige Befund für den Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und Beschäftigung ableiten: Die Einführung eines relativ niedrigen Mindestlohnes in einem System mit geringer sozialer Grundsicherung, das die Beschäftigungsanreize durch "In-Work-Benefits" (Kombilöhne) verbessert, hat in der Regel keine negativen Beschäftigungseffekte. Dies gilt empirisch zumindest, soweit sich hierdurch die vorhandene Lohnspreizung nicht wesentlich verringert und wenn ein Anstieg des Mindestlohnes durch eine günstige Wirtschaftslage aufgefangen wird. Großbritannien, Irland und auch die USA sind Beispiele.
Die Einführung eines im Vergleich zum Durchschnittseinkommen relativ hohen Mindestlohnes bei vergleichsweise großzügigem sozialem Sicherungsniveau, wie es in kontinentaleuropäischen Ländern üblich ist, führt hingegen tendenziell zu stärkeren Beschäftigungsverlusten vor allem bei den Hauptproblemgruppen des Arbeitsmarktes.
Dies liegt an höheren Anspruchslöhnen und einer lange Zeit niedrigeren Spreizung der Löhne als in angelsächsischen Ländern, durch die ein Teil des Angebots aus dem Markt und folglich in die Arbeitslosigkeit gedrängt wird. Die daraus resultierenden Probleme zeigen sich besonders deutlich in Frankreich, das in Bezug auf soziale Sicherung und Regulierung des Arbeitsmarktes eher mit Deutschland vergleichbar ist als etwa Großbritannien. Ist aber das institutionelle Umfeld ähnlich, so dürften bei vergleichbarer Wirtschaftslage auch die Beschäftigungseffekte einer Mindestlohnsteigerung in die gleiche Richtung gehen.
Verteilungspolitisch ineffizient
Bei der Beurteilung der sozialpolitischen Treffgenauigkeit und Effizienz von Mindestlöhnen ist zu prüfen, ob er ein geeignetes Umverteilungsinstrument ist oder ob überlegene Alternativen existieren.
In Bezug auf die Lohnstruktur am offiziellen Arbeitsmarkt sind drei Effekte eines Mindestlohnes denkbar:
* Der Anteil von Lohnempfängern unterhalb des Mindestlohns verschwindet.
* Der Anteil von Lohnempfängern, die den Mindestlohn oder etwas mehr beziehen, steigt.
* Es entwickelt sich ein Lohndruck nach oben, der die Stauchung der Lohnstruktur am unteren Ende wieder ausgleicht. Als Folge wird der gewollte Effekt unter sonst gleichen Bedingungen zugunsten der Niedrigeinkommensbezieher umzuverteilen, zwar absolut, aber keineswegs mit Sicherheit relativ erreicht. Da die Armutsmessung aber auf den relativen Abstand abstellt, tritt das angestrebte Ziel von weniger Niedrigeinkommensbeziehern auch bei steigenden Mindestlöhnen nicht ein.
Zudem müssen nominale und reale Wirkung nicht identisch sein, wenn sich andere Bedingungen parallel verändern. Können die Unternehmen höhere Arbeitskosten auf die Güterpreise abwälzen oder werden die Unternehmen gleichzeitig durch Steuerentlastungen begünstigt und die Arbeitnehmer belastet, fällt der reale Verteilungseffekt geringer aus.
So zeigen etwa die britischen Erfahrungen auch, dass sich dort trotz der absoluten Besserstellung der Niedriglohnbezieher die Ungleichverteilung zwischen Armen und Reichen in den letzten Jahren praktisch nicht verändert hat. Zudem wenden Kritiker ein, dass die britische Regierung parallel zum Mindestlohn die Lebenshaltungskosten durch Steuererhöhungen (Mineralöl, Versicherung, Kommunalsteuern) gesteigert hat, die besonders die Niedriglohnarbeiter treffen.
Ein traditioneller Einwand gegen den Mindestlohn ist außerdem, dass Haushaltsarmut durch Mindestlöhne nicht gezielt bekämpft werden kann. So gibt es Mindestlohnbezieher, die nicht in Haushalten mit geringem Einkommen leben, etwa Zweitverdiener oder Jugendliche, die bei ihren Eltern wohnen. Folglich verteilt der Mindestlohn in diesen Fällen nicht nach Bedürftigkeit um, sondern begünstigt auch die finanziell Bessergestellten. Das Ineffizienzproblem besteht aber auch, wenn ein Alleinverdiener einen etwas höheren gesetzlichen Mindestlohn bezieht und dennoch seine Beschäftigung nicht verliert. Denn trotz des etwas höheren Lohnes kann er häufig immer noch nicht den Bedarf decken, wenn er eine mehrköpfige Familie hat, und muss ergänzend staatliche Transfers beziehen.
Dass die mit einem einheitlichen Mindestlohn verbundenen verteilungspolitischen Ineffizienzen wegen der Missachtung des Bedürftigkeitsprinzips nicht gering sein dürften, zeigt auch ein Blick in die Empirie: Die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland mit Niedriglohn lebte 2004 in einem Haushalt mit einem weiteren Erwerbstätigen, der einen höheren Nettoverdienst erhielt. Dies sind vor allem Teilzeitbeschäftigte, die das Einkommen des Haupterwerbstätigen durch "Hinzuverdienst" aufstocken. Aber auch bei Vollzeitarbeitnehmern mit Niedriglohn leben 40 Prozent mit einem Besserverdienenden zusammen.
Verteilungspolitisch effizienter ist der Weg, "Armut trotz Beschäftigung" ganz gezielt nach dem spezifischen Haushaltsbedarf durch staatliche Transfers aufzustocken. Allerdings hat auch dieser Ansatz Haken und Ösen. Denn das Problem staatlicher Zuschüsse an Niedrigeinkommensbezieher besteht vor allem darin, dass sie bei dem hiesigen Grundsicherungsniveau und wegen umfangreicher Mitnahmeeffekte hohe fiskalische Kosten verursachen können.
Um dies zu vermeiden, sind zwei Bedingungen zu erfüllen: Erstens sollte eine Erwerbsarbeit finanziell attraktiver sein als der ausschließliche Bezug von Transfers. Zweitens sollte ein höheres Bruttoeinkommen, beispielsweise durch Mehrarbeit oder durch höherwertige Arbeit, auch zu höherem verfügbarem Einkommen führen. Prinzipiell könnte das im September von der Mehrheit des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) vorgestellte Modell diese Bedingungen erfüllen.
Es will den Hartz-IV-Grundleistungssatz für Erwerbsfähige senken, um neue Haushaltsbelastungen als Folge einer Ausweitung von Kombilöhnen zu vermeiden. Kombiniert werden soll dies mit einer deutlichen Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten. Parallel soll obligatorisch eine Beschäftigungsmöglichkeit angeboten werden, um die Arbeitsbereitschaft zu prüfen. Es soll aber weiterhin das volle Leistungsniveau gewährt werden, wenn kein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden kann.
Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen
Die Lehrbuchweisheit der "ceteris paribus", also unter sonst gleichen Bedingungen, per Saldo negativen Beschäftigungswirkungen eines hoch angesetzten Mindestlohnes bleibt trotz aller aktuellen theoretischen Modifikationen und uneindeutiger empirischer Befunde als Grundprinzip richtig. Erwünschte verteilungspolitische Ziele im unteren Einkommensbereich können grundsätzlich kostengünstiger durch andere Maßnahmen als einen nationalen Mindestlohn erreicht werden, wenn das staatlich garantierte Mindesteinkommen vergleichsweise hoch angesetzt ist, wie in Deutschland.
Diesen Befund bestätigen sowohl das Sondergutachten des SVR zu Kombi- und Mindestlöhnen als auch eine Expertise für das Land Sachsen unter zentraler Mitwirkung des gewerkschaftsnahen Mitglieds des Sachverständigenrates Peter Bofinger. Beide Gutachten mahnen große Vorsicht an. Insbesondere warnt auch das Bofinger-Gutachten, dass im Falle eines einheitlichen Mindestlohnes beim Überschreiten einer kritischen Marke negative Effekte dominieren. Besser als die Einführung eines relativ hohen Brutto-Mindestlohnes sei es, so heißt es weiter, "angemessene Nettolöhne und betriebswirtschaftlich vertretbare Arbeitskosten durch eine Senkung des Abgabenkeils (und damit über eine Bruttolohnsenkung) zu erreichen und nicht über die Einführung von Mindestlöhnen."
Zum Weiterlesen
Peter Bofinger/Martin Dietz/Sascha Genders/Ulrich Walwei: Vorrang für das reguläre Arbeitsverhältnis: Ein Konzept für Existenz sichernde Beschäftigung im Niedriglohnbereich. Gutachten für das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, August 2006
Lothar Funk/Hagen Lesch: Mindestlohnbestimmungen in ausgewählten EU-Ländern. In: Sozialer Fortschritt, 4/2006
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes Kombilohnmodell. Wiesbaden, September 2006