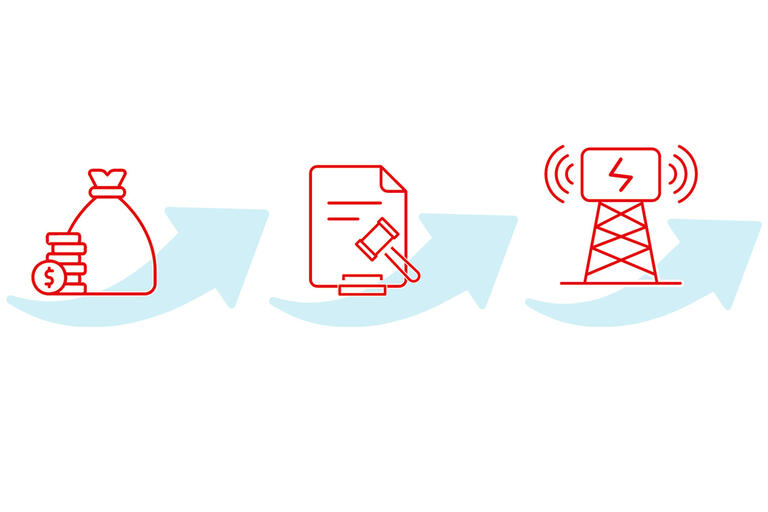: Weltwirtschaftskrise - wo bleibt Europa?
REGIERUNGSFÄHIGKEIT Die EU muss gemeinsam gesteuert werden - gegen den seit 1995 vorherrschenden marktliberalen Kurs.
Von Wolfgang Kowalsky, Referent beim Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) in Brüssel/Foto: Action Press
Der italienische Finanzminister Tremonti entdeckt, dass er in einem "verrotteten" System lebt. Kommissionspräsident Barroso veranstaltet eine "Konsultation" über eine mögliche Regulierung von Hedgefonds und Private Equity, wobei der Verdacht naheliegt, er wolle eine Gesetzesinitiative hinauszögern, wo er doch Europa als Speerspitze der Globalisierung sieht und auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Finanzmärkte setzte - immer eng an der Seite der Bush-Administration.
Aber das ist nicht länger en vogue. Zu dramatisch ist diese Krise. In Brüssel haben wir über Risiken der Globalisierung in den letzten Jahren wenig erfahren, kritisches Abwägen wurde umstellt von Denkverboten, so als sei ein Nachdenken über Regulierung des freien Marktes und Handels bereits protektionistisch. Es geht nicht darum, dem Protektionismus das Wort zu reden - es kann keine Lösung sein, wie die USA in der Großen Depression 1929 Warenzölle von 60 Prozent zu verhängen. Heute gibt es erfreulicherweise Ansätze von Kooperation und die europäische Währungsunion wirkt als Schutzschild.
ACHT MILLIONEN MEHR ARBEITSLOSE_ Doch stehen nach dem Ausbruch der - synchronisierten und multipolaren - Finanzkrise die Vorzeichen für die "Realwirtschaft" auf Sturm. Der Absatz brach gewaltig ein, an einem einzigen Tag im Januar wurden mehr als 70 000 Entlassungen gemeldet. Fast 70 Prozent aller Unternehmen, die in Deutschland pleitegehen, waren in den Fängen von "Heuschrecken". Prognostiziert wird bereits ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 17 auf 25 Millionen in Europa - Vorboten sozialer Revolten spielten sich in Athen, Sofia, Riga, Vilnius ab.
Die hässliche Seite der Globalisierung wird sichtbar, und ein von den USA ausgehender Dominoeffekt erfasst die freien Finanzmärkte. Schutz bieten jeweils nur die Nationalstaaten, die per Staatshaftung für die Verluste der Marktbeteiligten aufkommen, um einen totalen Kollaps abzuwenden. Das exzessive Ausmaß des Finanzsektors - ein unreguliertes Kasino von unfassbaren 50.000 Milliarden Dollar - diente keinem anderen ökonomischen Zweck als der Bereicherung der "Spieler" mit unabsehbaren Risiken für die globale Stabilität des Systems, wie Wolfgang Münchau, Mitbegründer der Financial Times Deutschland schreibt.
Zur gleichen Zeit, Ende 2008, schätzte die Bank of England die Schäden auf rund 2800 Milliarden Dollar - in der Regel zahlt das der Steuerzahler, vornehmlich Arbeiterklasse und Mittelschicht. Auf eine so tief greifende Krise mit der Herausforderung rapid wachsender Arbeitslosigkeit ist Europa denkbar schlecht vorbereitet.
LIBERALER DURCHMARSCH_ Jacques Delors haben wir die EBR-Richtlinie zu verdanken. Seit seinem Abgang als Kommissionspräsident 1995 hat im offiziellen Europa der ökonomische (Neo-)Liberalismus die Oberhand. Insbesondere die Barroso-Kommission hat die Selbstbeschränkung zum Programm erhoben und sorgte mit dafür, dass mit den Märkten die politischen Handlungskapazitäten nicht nachwuchsen. Das ist gescheitert.
Nun nehmen Regierungen - egal ob konservativ, neoliberal oder sozialdemokratisch geführt - Schwindel erregende Summen in die Hand und vollziehen (Teil-)Verstaatlichungen von Banken. Um den Wendepunkt nicht ganz zu verpassen, ließ Kommissionspräsident Barroso die nationalen Konjunkturprogramme wie einen Flickenteppich aneinanderfügen und präsentierte das 200-Milliarden-Paket als europäische Krisenantwort. Diese Aktion soll vorspiegeln, dass Europa handelt, obgleich die meisten Ausgaben bereits vor der Krise geplant waren. Wo bleibt der europäische sozialökologische New Deal? Wo die Vision einer nachhaltigen und kohärenten Industriepolitik? Unverzichtbar ist auch eine starke Rolle der öffentlichen Hand.
Ein ambitioniertes europäisches Investitionsprogramm, koordiniert mit dem US-amerikanischen und einem asiatischen, wäre nötig zur Förderung nachhaltiger Produktion und zur Bekämpfung des Klimawandels - dies ist auch die zentrale Herausforderung für den G-20-Gipfel in London. Je länger die freien Marktkräfte ungehindert walten, desto drastischer verschlechtert sich die Lage; und je tiefer die Krise, desto stärker der Druck auf das soziale Europa und die Beschäftigten, die letztlich unverschuldet die Zeche zahlen müssen.
SCHLEICHENDER NIEDERGANG_ Nicht allein das Machtgefüge zwischen Markt und Staat, auch das Kräfteverhältnis zwischen den EU-Institutionen und den Nationalstaaten verschiebt sich. Das offizielle supranationale Europa, das auf der Gemeinschaftsmethode basiert, scheint im schleichenden Niedergang: Die Kommission agiert wie ein Zuschauer, sortiert die vorliegenden Vorschläge der mächtigen Nationalstaaten, leistete der hyperaktiven französischen Ratspräsidentschaft Hilfestellung, beschränkt sich selbst auf Aufgaben eines Generalsekretariats, wie der Europaabgeordnete der Grünen Cohn-Bendit sarkastisch feststellte.
Eigentlich besteht ihre Hauptfunktion darin, "Motor der Integration" zu sein, ein Projekt auszuarbeiten und Initiativen zu seiner Umsetzung zu ergreifen, und nicht vornehmlich zu deregulieren und die Mitgliedstaaten mit Vertragsverletzungsverfahren zu verfolgen. Die Marginalisierung der EU-Kommission ist somit partiell selbstverschuldet.
Das abrupte Ende der neoliberalen Ära müsste eigentlich ein Geschenk für die europäische Linke sein. Doch wirkt diese wie anästhesiert, wie abwesend. Als der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Europas, Poul N. Rasmussen, im Europäischen Parlament im September einen Bericht zur Regulierung von Hedgefonds und Private Equity durchboxte, gab es kaum öffentliche Resonanz.
Angesichts der systemischen Krise gibt das Europäische Parlament ein eher schwaches Bild ab. Die einzige direkt gewählte Institution der EU verzichtet auf gründliche Diskussion von Gesetzesentwürfen und nickt Kompromisse ab wie zuletzt beim Klimaschutzpaket, das parallel mit den Regierungen ausgehandelt wurde. Die Laissez-Faire EU-Kommission ihrerseits unterlässt es, Vorschläge vorzulegen, die im Ministerrat der 27 Regierungen auf Opposition stoßen könnten. Impulse zu einer gemeinsamen wirtschaftspolitischen Willensbildung gehen von der Kommission schon seit geraumer Zeit nicht aus. Sogar die Europäische Zentralbank ist aktiver, ihr Präsident Trichet sagte, die Drei-Prozent-Haushaltsverschuldungsgrenze im Stabilitätspakt könne angesichts "außergewöhnlicher Umstände" überschritten werden (FTD 15.12.2008).
DANK AN FRANZOSEN_ Es war ein Glücksfall, dass die französische Ratspräsidentschaft unter Beweis gestellt hat, dass Europa angesichts der globalen Krise handlungsfähig ist. Sie war nicht bereit, das Klimaschutzpaket der Finanzkrise zu opfern, sondern ein Gleichgewicht zwischen ökonomischen und ökologischen Notwendigkeiten zu finden. Sie hat durch Kompetenz und Erfolg ein positives Bild von Europa verbreitet. Und ebenfalls dank der französischen Präsidentschaft könnte der Lissabonvertrag doch noch realisiert werden. Er könnte nach einem erneuten irischen Referendum im Herbst 2009 in Kraft treten, im Gegenzug kommt man Irland mit Vertragsänderungen entgegen. 2009 würde auch das Parlament vergrößert und eine neue 26-köpfige EU-Kommission eingesetzt - die nun auch nicht verkleinert werden soll.
Ob dieser positive Eindruck bis zur Europawahl im Juni 2009 vorhalten wird, ist ungewiss, denn die Kluft zwischen den Bürgern und der EU-Governance nimmt eher zu. Das doppelte Nein in Frankreich und den Niederlanden 2005 fiel - nicht zufällig - zusammen mit einem völligen Mangel an europäischer Führung. Das war nun anders. Die französische Präsidentschaft hat in den Wogen der Finanzkrise die Routine der Bürokratie und die Kalenderplanung durcheinandergeworfen und einen Arbeits-G4 einberufen. Sie hat erstmalig eine Eurogruppe von 16 Staats- und Regierungschefs eingeladen, dazu den Kommissions- und EZB-Präsidenten und damit den Prototyp der Economic Governance ins Leben gerufen.
Diese plötzliche und unerwartete Aufbruchstimmung in einem entscheidenden Moment hat gezeigt, dass Europa handlungsfähig ist, sofern der Wille dazu vorhanden ist. Es zeichnet sich aber ab, dass die tschechische Ratspräsidentschaft die energische, manchmal skrupellose Linie nicht fortsetzen kann.
Damit hatte die Stunde des Intergouvernementalen, der lockeren Zusammenarbeit der Staaten geschlagen: Die Nationalstaaten zeigten sich als die wahren Herren Europas, wobei die Dame zunächst einen angeschlagenen Eindruck machte.
VERÄNDERTE WETTBEWERBSREGELN_ Die Vorstellung, dass der Markt von sich aus notwendig das Gemeinwohl hervorbringt, ist vom Markt der Ideologien verschwunden. Ungewöhnlich rasch wurden die Binnenmarkt- bzw. Wettbewerbsregeln flexibilisiert, der Europäische Rat beschloss eine Lockerung des Beihilferechts und hob die Schwellenwerte auf 500.000 Euro an, mit denen die Nationalstaaten Unternehmen stützen können, was Deutschland und Frankreich bereits in Anspruch nahmen (siehe COM 751/2008 vom 17. November, S.?63?ff.).
Mehrere Stolpersteine liegen auf dem Weg zu einem gemeinschaftlichen Handeln: Da ist einmal die ideologische Denkweise der Kommissionsmehrheit, der Stabilitätspakt und Wettbewerbsregeln als unüberschreitbarer Horizont erscheinen. Dagegen änderte die französische Ratspräsidentschaft die Spielregeln und stellte durch Einberufung der Eurogruppe der Staatschefs den Primat der Politik wieder her.
Der Euro ist de facto ein innerer Kern der EU, aber Denkblockaden der Akteure machen es unmöglich, sich dies einzugestehen und entsprechend koordiniert zu handeln. So fehlt eine ökonomische Governance der EU.
Um mit China und Indien Schritt zu halten, ist ein gemeinschaftliches Vorgehen unabdingbar. Doch Europa bietet ein Bild von Segmentierung und Inkohärenz. Selbst der Ministerrat erwies sich als schwerfälliger "Spieler", und die Regel, dass alle 27 Länder einstimmig Entscheidungen treffen müssen - statt mehrheitlich -, unterminiert die Entscheidungsfähigkeit. Es rächt sich, dass die Osterweiterung von 15 auf 27 Länder erfolgte, bevor die europäischen Institutionen funktions- und politikfähig gemacht wurden. Und es wird zunehmend klarer, dass das Tempo nicht allein von den Bremsern bestimmt werden darf.
AGENDA FÜR DIE EUROPAWAHL_ Jahrelang hat die EU-Kommission - unterstützt von jüngsten EuGH-Urteilen - die Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitsmärkte gefördert. Jetzt sind ausgerechnet die flexibelsten Arbeitnehmer am stärksten von der Krise betroffen - Zeitarbeiter, befristet Beschäftigte, Kurzzeitbeschäftigte wandern ins Prekariat ab. Sie werden vom offiziellen Europa, vom Europa der Eliten genauso ausgeblendet wie die wachsende Kluft zwischen Kapitaleinkünften und Reallöhnen.
Laut Eurobarometer sind Arbeitslosigkeit, Wachstum und Kaufkraft für die Menschen die zentralen Themen der Europawahlen am 7. Juni. Offen ist, wie sich die gewaltige Krise auf diese Wahl auswirken wird. Werden sich die heute liberal-konservativ geprägten Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament verändern? Wird es einen Linksruck geben? Oder gehen noch weniger Bürger wählen? Seit der ersten Europawahl 1979 sinkt die Wahlbeteiligung stetig, von 63 Prozent auf 45,7 Prozent im Jahr 2004.
EU-Skeptizismus ist der treibende Motor der nächsten Europawahl, davon geht Claes H. De Vreese von der Universität Amsterdam aus. Er hat diese Haltung untersucht, die speziell seit der EU-Erweiterung und den Referenden 2005 in Frankreich, den Niederlanden und 2008 in Irland ein Faktor geworden sind. Dahinter steckt vor allem eine Anti-Establishment-Haltung, die Misstrauen gegenüber der EU-Governance mit Unzufriedenheit und zuweilen politischem Zynismus verbindet.
Die Ursache liegt im Agieren der EU, auch wenn euroskeptische Einstellungen häufig mit einer oppositionellen Haltung zur nationalen Regierung einhergehen. So war die Ablehnung der Europäischen Verfassung 2005 nicht gegen deren Inhalt gerichtet, sondern wurde als Gelegenheit genutzt, um einer generellen Skepsis gegenüber der EU Ausdruck zu verleihen.
Einige Indizien deuten auf eine tektonische Verschiebung hin. 2008 anerkannten 43 Prozent der Europäer/-innen, dass die EU vor den negativen Effekten der Globalisierung schützt, aber beachtliche 37 Prozent teilen diese Auffassung nicht.
Die Verbindungslinie zwischen der Haltung zur Globalisierung und einem EU-Skeptizismus sind unübersehbar. Zu diesem Bild passt, dass das offizielle Europa Diskussionen, unter welchen Bedingungen und in welchen Grenzen freier Handel möglich ist, wo immer zu vermeiden sucht. So warnte Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes auf der Konferenz "Neue Welt, neuer Kapitalismus" Anfang des Jahres in Paris erneut vor "der Falle des Protektionismus".
Wir sollten uns nicht allzu sehr von diesem Totschlagargument beeinflussen lassen. Die Krise könnte sich zu einem externen Impulsgeber für einen weiteren Integrationsschub entwickeln, insbesondere für die Euro-Mitgliedstaaten. Eine engere Koordination ist genauso notwendig wie die Neuausrichtung hin zu mehr Sozialorientierung und zu stärkerer sozial- und fiskalpolitischer Regulation. Eine nachhaltige Industriepolitik mit Produktivinvestitionen von einer ganz neuen Dimension sind nötig. Jetzt steht Europa und die Welt vor der Herausforderung, den sozial regulierten Kapitalismus neu zu erfinden und fair zu formieren.