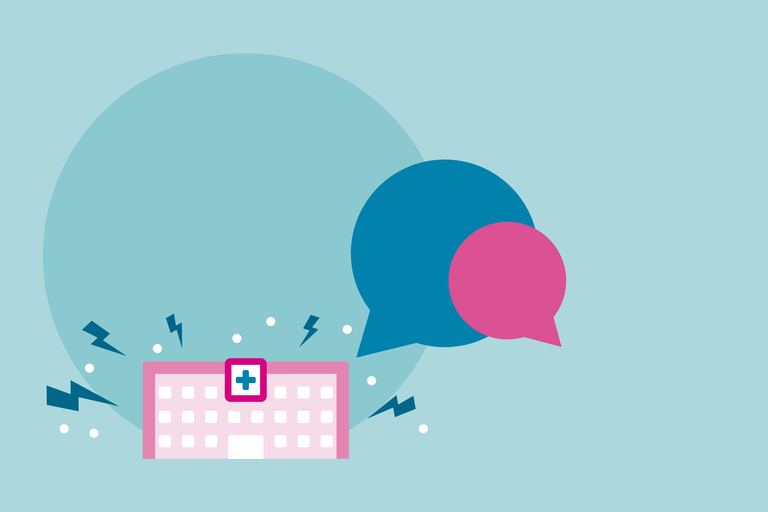Banken: Vom Zeitgeist geküsst
Die Genossenschaftsbanken sind besser durch die Krise gekommen als ihre Mitbewerber. Sie haben mehr Eigenkapital, mehr Vertrauen, weniger faule Posten in der Bilanz. Doch noch ist unsicher, ob sie langfristig von der Krise der anderen profitieren. Denn das Geschäft mit Privatkunden schwächelt. Von Marcus Pfeil
Was für ein schöner Freitagabend muss das für Rudolf Schmitz sein. Genossen aus der ganzen Republik sind heute wegen ihm in die abgelegene Kleinstadt Mayen gekommen, um ihn, den langjährigen Vize der Volksbank RheinAhrEifel, in den verdienten Ruhestand zu verabschieden. Nach Zander in Fenchelkruste und Rinderfilet verstummen die Loblieder auf den 62-Jährigen allmählich, jetzt klettert Schmitz endlich selbst aufs Podium. Er bringt das Mikrofon in Position, und dann sagt er, dass es vielleicht nicht das schlechteste sei, die Bank in einer Zeit zu verlassen, in der Banker vielerorts als gierige Monster beschimpft werden, die ihre Kunden über den Tisch ziehen und, wenn es schiefgeht, nach dem Staat rufen. „Aber das sind wir nicht. Wir sind anders als die anderen“, ruft Schmitz seiner Party zu. „Wir hatten das beste Jahr unserer Geschichte.“ Seinen letzten Satz verschluckt schon der Applaus in der alten Lokhalle.
Die Volksbank RheinAhrEifel eG ist eine von 1121 Genossenschaftsbanken in Deutschland, mit 135 000 Kunden und über 80 000 Mitgliedern die drittgrößte in Rheinland-Pfalz und gemessen an der Bilanzsumme bundesweit auf Platz 67. Sie ist nicht die einzige Genossenschaftsbank, die ein gutes Jahr hinter sich hat. Der gesamten genossenschaftlichen Finanzgruppe geht es seit Ausbruch der Finanzkrise ziemlich gut. Die Genossen sind im Gegensatz zu den Sparkassen und den Privatbanken ohne Staatshilfe ausgekommen. Allein in den vergangenen zwei Jahren haben sie über zehn Milliarden Euro nach Steuern verdient. Für die Ratingagentur Standard & Poor’s sind sie kreditwürdiger als die Deutsche Bank.
EIN NEUES SELBSTWERTGEFÜHL BREITET SICH AUS
Die Genossenschaftsbanken verfügen über jene Art von Kapital, das viele Groß- und Landesbanken verspielt haben: Vertrauen. Eine Million Neukunden haben seit 2008 ein Konto bei einer der Volksbanken oder Raiffeisenkassen, Sparda- oder PSD-Banken eröffnet, fast 800 000 Kunden haben eine Mitgliedschaft beantragt, 17 der insgesamt 30 Millionen Kunden sind damit gleichzeitig Eigentümer ihrer Bank. Bundesbank-Chef Jens Weidmann hat den Genossen bescheinigt, „von allen drei Säulen des deutschen Bankensystems am besten durch die Krise gekommen zu sein“. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte die alte Idee des konservativen Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen und des liberalen Politikers Hermann Schulze-Delitzsch von Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung zu einem „Modell der Zukunft“. Jeder neue Bankenskandal lässt die Anhängerzahl wachsen. Und die Genossen? Sie wirken wie Menschen, die ihr Glück noch immer nicht fassen können.
Einige preisen Raiffeisen plötzlich als Vater der sozialen Marktwirtschaft, andere rufen gar einen „dritten Weg“ zwischen Raubtierkapitalismus und Planwirtschaft aus, reden von „Member“ statt „Shareholder-Value“. Immer wieder hört man den Satz: „Jahrelang wurden wir als biedere Bank belächelt, jetzt sind wir wieder wer.“ Neues Selbstwertgefühl paart sich mit dem alten Minderwertigkeitskomplex und verdichtet sich zu der Frage: Sind die Genossenschaftsbanken tatsächlich anders? Sind sie die bessere Bank? Oder hat sie eher zufällig der Zeitgeist geküsst, der Trend von der Rückbesinnung auf die Region, von Gemeinsamkeit und Teilen mitgerissen? Wie verwurzelt können die Genossen nach unzähligen Fusionen überhaupt noch sein, wenn es heute 4632 Institute weniger gibt als noch vor 40 Jahren? Funktioniert die Idee der sozialen Kontrolle, bei der diejenigen, die Geld einzahlen, jene kontrollieren, die Geld bekommen, da noch?
Dass Uwe Fröhlich, Präsident des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) von einem „überlegenen Geschäftsmodell“ spricht, überrascht nicht. Aber haben die Volks- und Raiffeisenbanken ihren Kunden nicht auch Schiffsbeteiligungen aufgeschwatzt? Haben die Genossen ihrer Zentralbank, der DZ Bank, nicht auch eine Eigenkapitalspritze verabreichen müssen? Weil die DZ zu viele Anleihen aus Griechenland, Spanien und Italien im Depot hatte und deshalb 2011 3,3 Milliarden Euro abschreiben musste? Und drohen ihr nicht weitere Wertminderungen, weil sie noch immer Papiere aus den südeuropäischen Staaten in Höhe von etwa elf Milliarden besitzt? Auf der anderen Seite haben die Genossen nur die DZ Bank und nicht, wie die Sparkassen, sieben Landesbanken durch die Krise schleppen müssen. Ihre grundsoliden Tochterfabriken Schwäbisch Hall, R+V-Versicherung und Union Investment beliefern die 1121 Institute seit Jahrzehnten zuverlässig mit Bausparverträgen, Versicherungspolicen und Investmentfonds. Die Institutssicherung, in die Banken, die höhere Risiken eingehen, mehr einzahlen als risikoarme Banken, gilt als vorbildlich.
KUNDEN OHNE EC-KARTE
Elmar Schmitz, Chef der Volksbank RheinAhrEifel und nicht verwandt mit Rudolf Schmitz, arbeitet seit 32 Jahren bei der Bank. An diesem Morgen sitzt er in seinem schlichten Bankvorstandsbüro. Hinter ihm an der Wand prangen Fotos mit den Wahrzeichen der Region, der Nürburg, der Ahr und der Benediktinerabtei Maria Laach, davor der Claim „Wir sind Heimat“. Schmitz sagt: „Ich brauche hier kein Navi. Wir machen noch Geschäfte, die wir können, mit Menschen, die wir kennen.“ Vor ein paar Tagen hat er Anton Mannheim kennengelernt. Mannheim kommt aus Brohl am Rhein, der Rentner trägt eine beigefarbene Anglerweste, seine riesigen Hände zeugen davon, dass er jahrelang als selbstständiger Elektroinstallateur sein Geld verdient hat. Er gehört zu jenen Bankkunden, denen die Volks- und Raiffeisenbanken ihr Kartoffelbankenimage verdanken. Bis heute hat der 67-Jährige keine EC-Karte, zahlt nur bar, und seine Bankgeschäfte, also Überweisungen, erledigt er am Schalter. Mannheim ist seit 40 Jahren Genosse bei der Volksbank.
RheinAhrEifel, die Bank, hat sein Haus finanziert, als Eigentümer kam er früher immer zu den Mitgliederversammlungen, und auch als die Bank so groß wurde, dass sie zu viele Mitglieder hatte, war er jahrelang einer der 600 Vertreter, die die Eigentümer auf den Versammlungen repräsentierten. Bis die immer „glatter abgelaufen sind“. Früher sei man am Abend noch gemütlich beisammengesessen, sagt Mannheim. „Der persönliche Bezug schwindet.“ In letzter Zeit hat sich Mannheim immer öfter über seine Bank geärgert: Weil in Brohl, in seiner Filiale, das Personal wechselte, aber auch weil die Spanne zwischen Überziehungs- und Einlagenzinsen zu hoch sei. „Kein Unterschied mehr zu den Großbanken“, sagt er. Er habe Angst um den genossenschaftlichen Gedanken. Und deshalb schrieb er der Bank einen dreiseitigen Brief. Zwei Tage später hat ihn Elmar Schmitz angerufen, sie haben sich getroffen und zwei Stunden miteinander geredet. Schmitz sagt, er mache das immer so, wenn sich ein Kunde beschwert.
Als Elmar Schmitz 1981 bei der Bank angefangen hat, gab es noch 50 Filialen mehr. Aber man kann die Zeit nicht anhalten. „Nähe kostet Geld. Und weil wir immer noch stärker in der Fläche sind als alle anderen Banken, haben wir auch höhere Kosten“, sagt der 56-Jährige. Deshalb die Fusionen, deshalb die schlechteren Konditionen, über die sich Mannheim beschwert. Das Geschäftsmodell der Genossen ist nun mal das klassische Bankgeschäft: Sie zahlen niedrige Zinsen an Privatkunden wie Mannheim und verleihen deren Geld teurer an Mittelständler wie Lothar Rosenbaum. Der 51-Jährige restauriert mit seinen 40 Mitarbeitern Kirchtürme, baut Holzhäuser und konstruiert Dachstühle. Rosenbaum ist seit seiner Kindheit Kunde der Volksbank, seit über 20 Jahren, seit er die Zimmerei und das Sägewerk seines Vaters übernommen hat, auch Firmenkunde. Der Vater beschäftigte fünf Mitarbeiter; er hat nie einen Kredit aufgenommen. Lothar Rosenbaum dagegen hat für 450.000 Mark eine CNC-Maschine für den Holzabbund auf Pump finanziert, trotz väterlicher Bedenken.
Schon nach drei Jahren hatte er den Kredit abgelöst. Heute macht er jedes Jahr zwischen vier und fünf Millionen Umsatz. Rosenbaum hat den Geländewagen vor dem Haus abgestellt. Er sitzt in seiner Küche, die er aus Douglasie gezimmert hat, einen grauen Pullunder über dem karierten Hemd, und erzählt davon, dass die besten Geschäfte, die er gemacht habe, jene ohne Vertrag waren. Er brauche Nähe, gerade in Gelddingen. Zu Zeiten des Neuen Marktes sei er mal auf die Schnauze gefallen, weil ihm die Commerzbank einen Fonds empfohlen habe. Schon damals habe es ihn geärgert, dass er den Berater nicht persönlich kannte, dass ihn keiner angerufen hat, um sich zu entschuldigen. Deshalb mag er die Volksbank, weil er sich wie auf seiner Baustelle auf Leute verlassen will. So wie auf seinen Berater Peter Schäfer. Ihn kennt er seit der Kindheit, die Väter gingen schon zusammen zur Kirche, der eine war Kirchenrechner, der andere Messdiener. „Man muss den Bauch treffen“, sagt Rosenbaum. Das sei wichtiger als die Frage, ob ein Kredit 4,1 oder 4,3 Prozent kostet.
DER SCORING-WERT ENTSCHEIDET NICHT ALLEIN
Zwar entscheiden auch bei den Genossen Scoring-Ampeln, ob die Bank Menschen wie Rosenbaum einen Kredit gewährt – aber eben nicht allein. Leuchtet die Ampel gelb, entscheiden Banker wie Schäfer. Das Kreditgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen wächst seit 2008 mit etwa vier Prozent stärker als bei der Konkurrenz, im laufenden Jahr stieg das Kreditvolumen sogar um sieben Prozent, bei Banken und Sparkassen im Schnitt nur um 2,5 Prozent. Inzwischen kommen 15,5 Prozent aller Unternehmenskredite in Deutschland aus den Tresoren der Genossen, die Großbanken kommen auf 13 Prozent. Und die Abschreibungen auf faule Kredite seien im Vergleich zu den Sparkassen relativ niedrig, sagt Udo Steffens, Präsident der Frankfurt School of Finance & Management. Lothar Rosenbaum hat seine Kredite bislang immer pünktlich zurückgezahlt. Sein Kreditrahmen liegt im Schnitt bei 500.000 Euro, derzeit bekommt die Volksbank dafür nicht einmal drei Prozent. Sonst verdient die mit ihm nicht so viel mehr als mit Anton Mannheim, weil Rosenbaum sein Geld vor allem in die Firma steckt, aber nicht in Zertifikate oder Bonussparpläne.
Im Gegensatz zum Kreditgeschäft sei das Privatkundengeschäft die Schwäche der Genossen, sagt Dirk Schiereck von der TU Darmstadt. Sie verkaufen zu wenig. „Die meisten der 30 Millionen Kunden sind relativ ertragsschwach“, sagt auch Steffens. So macht etwa das Privatkundengeschäft der Volksbank Mittelhessen Verluste, weil mehr als jeder zweite Kunde über weniger als 5000 Euro Vermögen verfügt und sich der Verkauf von Bausparverträgen und Fondssparplänen nicht rechnet. Elmar Schmitz kennt das Problem. Zwar hat seine Bank im vergangenen Jahr ein Kreditwachstum von sechs Prozent erwirtschaftet, das Neukreditvolumen stieg sogar um 28 Prozent, aber auch seine Bank verdient zu wenig mit Privatkunden. Wenn die Realeinkommen nur schwach steigen, trifft das die Volksbanken stärker als andere. Mit Durchschnittskunden lässt sich kaum mehr verdienen. Elmar Schmitz überlegt, jenen Kunden, die sämtliche Bankgeschäfte über die Volksbank abwickeln, die Kontoführungsgebühren von 7,90 Euro im Monat zu erlassen.
Auch Schmitz muss sich fragen, ob auch eine Bank wie seine das Vertrauen ihrer Kunden verspielen kann, wenn sie zu weit geht. Bis vor drei Jahren hat schließlich auch sie ihren Kunden lukrative Schiffsbeteiligungen aufgeschwatzt. Und natürlich Zertifikate. „Die Volks- und Raiffeisenbanken sind keine Heiligen, sie beraten nicht unabhängiger und besser als die anderen. Die eigenen Produkte haben beim Vertrieb natürlich Vorrang“, sagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die DZ Bank habe nicht umsonst die Deutsche Bank als größten Zertifikate-Anbieter abgelöst. Nauhauser belegt seine Zweifel mit zwei Studien, die er kürzlich durchgeführt hat. Danach würden die Genossen sich ebenso weigern, ihre verdeckten Provisionen offenzulegen wie andere Banken. Und auch die seit 2010 verpflichtenden Beratungsprotokolle würden auch bei den Volksbanken nur selten den Inhalt eines Beratungsgesprächs wiedergeben. Vielmehr gehe es oft allein darum, sich der Haftung zu entziehen, sagt Nauhauser.
Elmar Schmitz ärgert sich über solche Vorwürfe, mehr noch bringt ihn die Regulierungswut auf die Palme. Es gefällt ihm nicht, dass jeder Bankberater unter Generalverdacht steht. Anders als die Verbraucherschützer glaubt er nicht daran, dass ein Beratungsprotokoll die Beratung verbessert. Schmitz steuert seine Leute nicht über Abschlüsse, sondern über Kontakte. „Vertrauen geht nur über Kontakt“, sagt er. 60 Kundentermine muss jeder Berater pro Monat vereinbaren, zwölf Neukunden pro Jahr akquirieren. „Da liegen wir drüber.“ Damit das so bleibt, hat er ein neues Arbeitszeitmodell eingeführt, zweimal pro Woche muss jeder Berater bis 19 Uhr bleiben, weil viele Kunden pendeln und vor 16 Uhr keine Zeit haben. Der Bonus der Berater hänge nicht an der Zahl verkaufter Fondssparpläne, sondern am Gesamtergebnis der Bank, sagt er. Es gebe auch keine Ranglisten unter den Mitarbeitern wie bei anderen Banken. Doch er ahnt auch, dass es vielleicht nur ein flüchtiger Trend ist, der die Kunden zu ihnen treibt. „Wenn wir so gut wären, hätten wir da nicht besser sein müssen als das bisschen Wachstum?“