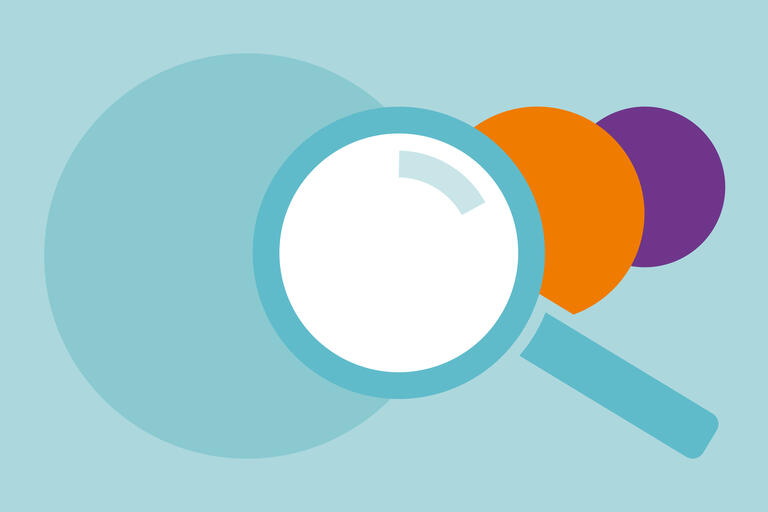Steuerreformen: Verlorene Milliarden
In den vergangenen 15 Jahren hat die Politik kräftig die Steuern gesenkt. Dadurch fehlen dem Staat jetzt jährlich rund 45 Milliarden Euro. Von Achim Truger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Anfang Mai war es mal wieder so weit. Nach Veröffentlichung der jüngsten Steuerschätzung waren überall Rekordmeldungen zu lesen: 2013 werde der Staat so viel Geld einnehmen wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. In den zwei Jahren zuvor hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zudem beim Kassensturz regelmäßig verkünden können, dass er ja viel mehr Geld hat als noch vor Kurzem gedacht. Also alles bestens mit den Steuereinnahmen?
Über die regelmäßig vorgetragene Geschichte vom Geldregen für den Staat darf man zwei Dinge nicht vergessen: Erstens sind in einer nominal wachsenden Wirtschaft jährliche Rekordeinnahmen der Finanzämter völlig normal. Erst fünfmal fiel in der Geschichte der Bundesrepublik das Steueraufkommen geringer aus als im Vorjahr – entweder weil die Steuern gerade gesenkt worden waren oder weil die Wirtschaft in einer schweren Krise steckte. Und zweitens: Im Frühjahr 2008, also kurz vor der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, prognostizierten die Steuerschätzer dem Staat noch ganz andere Einnahmen. Die Lücke zwischen den damaligen Erwartungen und den tatsächlich eingenommenen Steuern beläuft sich inzwischen auf mehr als 200 Milliarden Euro, allein im Jahr 2012 waren die Einnahmen um über 45,5 Milliarden Euro geringer als vor der Krise erwartet.
Die Krise hat die deutschen Staatseinnahmen also stark in Mitleidenschaft gezogen. In den ersten beiden Jahren 2009 und 2010 dominierten dabei vor allem die konjunkturellen Effekte. Weil die Wirtschaft 2009 drastisch geschrumpft war, nahm der Staat auch deutlich weniger ein als zuvor geschätzt. Doch 2011 und 2012 drehte sich das. Seither hat die Lücke eine ganz andere Ursache: die Steuersenkungen aus den Konjunkturpaketen sowie dem Bürgerentlastungs- und dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Im vergangenen Jahr klaffte somit im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2008 eine strukturelle Einnahmelücke von 36,5 Milliarden Euro. Auch mehr als vier Jahre nach Ausbruch der Krise haben sich die Steuereinnahmen bei Weitem noch nicht von der großen Rezession erholt. Die Politik der Steuersenkungen spielte dabei eine wesentliche Rolle. Und die hat mittlerweile eine Tradition von fast 15 Jahren.
IMMER WEITER GESENKT
Schon vor der Krise hat die Politik die Staatsfinanzen erheblich geschwächt. Einen starken Anteil daran hat auch die damalige rot-grüne Bundesregierung. Die Steuerreform 2000 schlug mit Senkungen der Einkommensteuer und einer großen Unternehmenssteuerreform kräftig zu Buche. Zu einem großen Teil kam das wohlhabenden Haushalten zugute. Beispielsweise wurde der Spitzensteuersatz schrittweise von 53 auf 42 Prozent gesenkt oder die Besteuerung von Kapitalerträgen aus der Einkommensteuer herausgelöst. Mit der Abgeltungssteuer greift jetzt nur noch ein günstiger Satz von 25 Prozent, während Lohneinkünfte voll besteuert werden. Insgesamt lagen die Einnahmeausfälle während der Kanzlerschaft Gerhard Schröders von 2001 bis 2005 zwischen 24 und 43 Milliarden Euro pro Jahr. Auch in diesem Jahr rissen sie noch ein Loch von schätzungsweise 50 Milliarden Euro in die Staatskasse.
Die Große Koalition schlug zunächst einen anderen Kurs ein. Per saldo verbesserten die in den Jahren 2006 und 2007 beschlossenen steuerpolitischen Maßnahmen die Haushaltslage erheblich, wenn auch nicht gerade auf sozial gerechte Art – vor allem wurde 2007 die Mehrwertsteuer erhöht. Wäre es dabei geblieben, wären durch die Große Koalition die vorausgegangenen Steuerausfälle etwa zur Hälfte wieder ausgeglichen worden. 20 Milliarden Euro an Steuerausfällen wären geblieben. Allerdings beschloss die Große Koalition in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise eine Reihe auch steuerpolitischer Maßnahmen, viele davon mit andauernder Wirkung.
So wurde die Einkommensteuer in zwei Schritten um etwa sechs Milliarden Euro jährlich gesenkt, die alte Pendlerpauschale wieder eingeführt (2,5 Milliarden Euro jährlich) und das sogenannte Bürgerentlastungsgesetz und damit die weitgehende steuerliche Abzugsfähigkeit der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung von der Einkommensteuer (etwa neun Milliarden Euro jährlich) verabschiedet. Mehrere befristete Maßnahmen bei den Unternehmenssteuern schlugen ebenfalls kräftig zu Buche. Im Ergebnis wurden damit seit 2010 die Steuermehreinnahmen der Großen Koalition fast wieder aufgezehrt. Die schwarz-gelbe Koalition hat die Lage der öffentlichen Haushalte gegen den einhelligen Rat fast aller Experten dann durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz erneut erheblich verschärft; die Einnahmeausfälle betragen jedes Jahr etwa neun Milliarden Euro.
Gegenwärtig belaufen sich die steuerreformbedingten Ausfälle aller drei Regierungen auf rund 45 Milliarden Euro jährlich; der Spitzenwert lag 2011 sogar bei 53 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das durchschnittliche gesamtstaatliche Haushaltsdefizit von 2000 bis 2012 lag bei knapp 46 Milliarden Euro. Ohne die Steuerausfälle hätte es in vielen Jahren rein rechnerisch also überhaupt kein Haushaltsdefizit gegeben; Deutschland hätte den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht verletzt, und der öffentliche Schuldenstand könnte um über 480 Milliarden Euro und damit in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 18 Prozentpunkte geringer sein.
Während die öffentlichen Haushalte mit einer strukturellen Unterfinanzierung kämpfen müssen, wird in den kommenden Jahren zudem immer mehr die Schuldenbremse greifen. Makroökonomisch ist das ein extrem riskanter Kurs. Denn aufgrund der immensen Aufkommenslücken durch die Steuersenkungen der vergangenen Jahre droht nun eine strikte Sparpolitik bei den Ausgaben. Diese dürfte auch negative Folgen für Wachstum und Beschäftigung haben. Sicher ist zudem, dass die Bürger Einschnitte bei der Versorgung mit öffentlichen Gütern, Dienstleistungen und bei der sozialen Sicherheit treffen werden. Dass Bundestag und Bundesrat also parallel zu dauerhaften Steuersenkungen die Schuldenbremse beschlossen haben, war daher ökonomisch und staatspolitisch mehr als fahrlässig. Schon allein aus diesen Gründen wäre es makroökonomisch, aber letztlich auch haushaltspolitisch vernünftig gewesen, auf die Schuldenbremse im Grundgesetz zu verzichten.
UNGLEICHHEIT VERSTÄRKT
Die Reformen haben nicht nur den Staatshaushalt enorm belastet, sondern auch den ohnehin schon bestehenden Trend zu einer zunehmenden Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung weiter verschärft. Zwar schlugen die Erhöhung des Kindergeldes und das Schließen einiger Steuerschlupflöcher positiv zu Buche. Durch die starke Absenkung des Spitzensteuersatzes der Einkommensteuer, die steuerliche Bevorzugung des Faktors Kapital im Rahmen der Abgeltungssteuer, die Senkung der Erbschaftsteuer und die wiederholten kräftigen Entlastungen für die Unternehmen wurden insgesamt jedoch reiche Haushalte und Unternehmen überproportional entlastet. Die Erhöhung der Umsatzsteuer im Jahr 2007 traf dagegen gerade die Bezieher geringer und mittlerer Einkommen.
Aber darf man denn überhaupt über Steuerausfälle und verteilungspolitische Schieflage lamentieren? Haben die Reformen denn nicht Wachstum und Beschäftigung angekurbelt? Immerhin war dies ihr erklärtes Ziel. Dafür spricht schon theoretisch wenig. Auch die praktischen Erfahrungen waren entmutigend. Es ist frappierend, dass die Phase großzügiger Steuersenkungen im Rahmen der Steuerreform 2000 identisch ist mit der langen Stagnationsphase der deutschen Wirtschaft, während der Aufschwung 2006 und 2007 genau in eine Phase deutlicher Steuererhöhungen fällt. Offensichtlich haben die Steuersenkungen nicht den erhofften Wachstumsschub gebracht. In Wirklichkeit waren sie sogar kontraproduktiv, denn sie führten eine drastische Sparpolitik auf der Ausgabenseite herbei. Diese schwächte Wachstum und Beschäftigung empfindlich.
Der Grund für die derzeit scheinbar sprudelnden Steuereinnahmen liegt vor allem darin, dass sich Deutschland sehr schnell von der globalen Wirtschaftskrise erholt hat. Nach einem drastischen Einbruch 2009 erholten sich vor allem die Exporte rasant und zogen die deutsche Wirtschaft aus der Krise. Zudem war die Krise auf dem Arbeitsmarkt vor allem durch Kurzarbeit, flexible Arbeitszeitkonten und kluges Krisenmanagement von Staat, Gewerkschaften und Arbeitgebern überbrückt worden. Noch 2010 hatte damit aber niemand gerechnet, entsprechend pessimistisch waren die Steuerschätzer damals. Für die öffentlichen Haushalte war das unerwartet hohe Wachstum sehr positiv. Die geringere Arbeitslosigkeit ging mit geringeren Zahlungen an Arbeitslosenunterstützung sowie höheren Sozialbeiträgen einher. Am deutlichsten machte sich der Aufschwung jedoch beim Steueraufkommen bemerkbar. So wurden die Aufkommensprognosen und das tatsächliche Aufkommen sukzessive nach oben korrigiert. Die Erfolgsmeldungen waren geboren. Im Jahr 2012 lag das Gesamtaufkommen der Gebietskörperschaften nach der Steuerschätzung um 60 Milliarden Euro über dem 2010 erwarteten Wert, aber doch 45,5 Milliarden Euro unter dem, was 2008 – also vor der großen Rezession – erwartet worden war.
STEUERPOLITIK URSACHE DER DEFIZITE
In Deutschland ist die These weit verbreitet, dass wir „über unsere Verhältnisse“ leben und uns mit den Staatsschulden an kommenden Generationen versündigen. Die Richtung ist dabei klar: Der Staat gibt immer mehr aus. Die Lösung liegt dann nahe: Die Politik muss sparen. Allerdings entbehrt diese Analyse jeder Grundlage. Wenn man die Staatsausgaben zum BIP ins Verhältnis setzt, zeigt sich, dass diese Ausgabenquote seit Mitte der 1990er Jahre fällt. Die einzige Ausnahme bildet der kurze Sprung der Ausgaben im Rahmen der Konjunkturpakete in der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Gänzlich ad absurdum geführt wird die These von einer unsoliden Ausgabenpolitik des deutschen Staates gerade im internationalen Vergleich. So war die staatliche Ausgabenentwicklung in den zehn Jahren vor der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise extrem zurückhaltend: Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der gesamtstaatlichen Ausgaben für die Jahre 1999 bis 2012 liegt in Deutschland bei nominal 1,7 Prozent. Real – also bereinigt um die Inflationsrate – sind die deutschen Staatsausgaben sogar nur um 0,8 Prozent pro Jahr gewachsen. Der Durchschnitt der alten EU-Länder liegt mit einem nominalen Wert von 3,4 Prozent knapp doppelt so hoch. Auch verzeichnete in diesem Zeitraum kein anderes entwickeltes Land mit Ausnahme von Japan ein niedrigeres Staatsausgabenwachstum als Deutschland.
Dabei müsste der Staat eigentlich dringend investieren. Damit eine Volkswirtschaft florieren kann, ist sie auf eine gut funktionierende Infrastruktur angewiesen. Dazu zählt neben Straßen oder der Wasserversorgung auch ein gutes Bildungssystem. Davon haben auch die Unternehmen etwas. Die Vorleistung der öffentlichen Hand erhöht das unternehmerische Produktionspotenzial und senkt die Kosten. Fallen die staatlichen Investitionen zu gering aus, wird sich dies langfristig negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken.
Gerade auch im Bildungsbereich können zu geringe öffentliche Investitionen negative Auswirkungen haben. Ist etwa das Lernumfeld von Kindern – also in erster Linie Schulen, zu denken ist aber auch an Kindertageseinrichtungen – in einem schlechten Zustand, hat dies Folgen für die Leistung der Schüler und die Effektivität des Unterrichts. Zu nennen sind hier etwa der Zuschnitt von Klassenräumen, der Lärmpegel, die Beleuchtung, die Akustik und vieles mehr. Zudem können unterlassene Investitionen gravierende Umweltprobleme und damit auch Kosten hervorrufen. Ein Beispiel ist die Abwasserkanalisation, bei der undichte Leitungssysteme etwa zur Verunreinigung des Grundwassers führen. Bedacht werden muss in Bezug auf die öffentliche Investitionstätigkeit, dass gerade mit Blick auf die zwischenzeitliche Unterlassung von Ersatzinvestitionen – das heißt, wenn etwa Schäden bei Straßen nicht rechtzeitig beseitigt werden – die Kosten im Laufe der Zeit noch steigen. Doch in Deutschland entwickeln sich die öffentlichen Investitionen seit Beginn der 1970er Jahre im Verhältnis zum BIP rückläufig. Das ist zwar ein allgemeiner internationaler Trend, aber im Vergleich war der Rückgang in Deutschland wesentlich stärker ausgeprägt. 2012 wies die deutsche staatliche Investitionsquote mit nur 1,5 Prozent des BIP nach Österreich den zweitniedrigsten Wert der Länder des Euroraums auf. Der Euroraum-Durchschnitt ohne Deutschland lag – trotz zuletzt krisenbedingter Kürzungen in vielen Ländern – bei immerhin 2,3 Prozent des BIP.
Ein wesentlicher Grund für die geringen Investitionen sind die Konsolidierungsbemühungen: Wenn zum Beispiel Gemeinden oder Landkreise ihre Ausgaben beschränken müssen, tun sie das am ehesten, indem sie nötige Investitionen etwa in die Schulgebäude einfach unterlassen. Auch bei den öffentlichen Bildungsausgaben, die überwiegend durch die Bundesländer getätigt werden, steht Deutschland im OECD-Vergleich schlecht da. Zwar kompensieren die hohen Privatausgaben im Rahmen des dualen Systems zum Teil die geringen öffentlichen Ausgaben, aber auch öffentliche und private Ausgaben zusammen liegen noch deutlich unter dem OECD-Durchschnitt: Würden die deutschen Bildungsausgaben auf den Durchschnittswert angehoben, dann müssten etwa 25 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden. Wollte man die Spitzenreiter einholen, wären rund 70 Milliarden Euro notwendig.
Der Bedarf an zusätzlichen öffentlichen Investitionen im ökonomischen Sinne ist also sehr groß. Verschärfend kommt hinzu: Die öffentliche Verwaltung hat in den letzten beiden Jahrzehnten einen gewaltigen Schrumpfungsprozess durchlaufen, und die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst sind weit hinter der ohnehin schon schwachen gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung zurückgeblieben. Zur Korrektur dieser Fehlentwicklungen müssten sicherlich auch noch erhebliche Mittel veranschlagt werden. Hinzu kommen berechtigte Wünsche nach einer Aufstockung sozialer Leistungen. Insgesamt lässt sich mittelfristig ohne Übertreibung durchaus ein Ausgaben- und damit auch Finanzbedarf in einer zwei- bis dreistelligen Milliardensumme ausmachen.
AM SCHEIDEWEG
Natürlich kann eine Finanzierungslücke solchen Ausmaßes nicht von heute auf morgen geschlossen werden. Durch eine mittelfristige Anhebung der Steuern für sehr wohlhabende Haushalte und Unterehmen würde man aber bereits die wesentlichsten Schritte in die richtige Richtung gehen. Die Sicherung der staatlichen Handlungsfähigkeit stellt dabei auch in Zeiten der Schuldenbremse im Wesentlichen kein ökonomisches, sondern ein politisches Problem dar. Wer einen leistungsfähigen Sozial- und Investitionsstaat haben möchte, kann diesen theoretisch auch realisieren. Die zentrale Frage ist, ob es gelingen kann, die politische Zustimmung zu den dafür notwendigen höheren Steuern zu gewinnen. Bislang schien die deutsche Finanzpolitik in einem Teufelskreis gefangen: Verschlechterungen von staatlichen Leistungen minderten die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, die Finanzausstattung des Staates sank durch Steuersenkungen – öffentliche Leistungen wurden auf diesem Weg immer weiter gekürzt, und die öffentliche Hand verlor an Handlungsfähigkeit und Zustimmung. Wünschenswert wäre es, aus dem pessimistischen in ein optimistisches Szenario auszubrechen und einen Tugendkreis aufzubauen: Ein hohes öffentliches Leistungsniveau zusammen mit einer als gerecht empfundenen Staatsfinanzierung stärkt die Bereitschaft, durch Steuern zur Finanzierung öffentlicher Leistungen beizutragen, und ermöglicht damit wiederum das hohe Leistungsniveau.
Die deutsche Steuer- und Finanzpolitik steht damit letztlich an einem Scheideweg. Gelingt es, die strukturelle Unterfinanzierung durch sozial gerechte Steuererhöhungen zu beheben, dann liegen die Sicherung der staatlichen Handlungsfähigkeit und die zentralen Zukunftsinvestitionen in greifbarer Nähe. Werden die notwendigen steuerpolitischen Schritte unterlassen, kann man nur noch auf anhaltendes großes Konjunkturglück hoffen. Bleibt dieses aber aus, ist eine Fortsetzung der langjährigen Entstaatlichungspolitik mit allen wirtschaftlichen und sozialen Folgen vorprogrammiert.