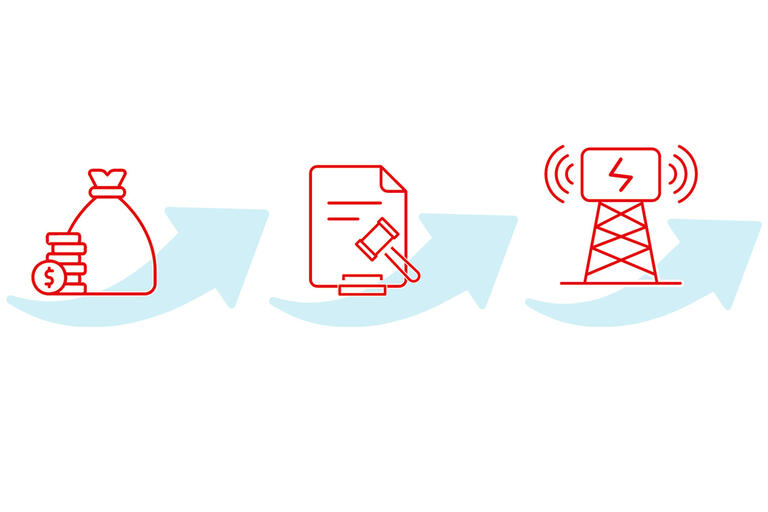Ländervergleich: Riesen und Zwerge
In vielen unserer Nachbarländer schrumpft die Industrie, was den Volkswirtschaften nicht gut bekommt. Deutschland und Polen sind viel stärker aufgestellt. Doch auch sie zahlen ihren Preis. Von Andreas Schulte
Großbritannien: Der Staat redet viel, aber tut wenig
Es schien, als habe Premierminister David Cameron Lehren aus der Finanzkrise gezogen. Eine neue Balance zwischen dem Dienstleistungssektor, der Finanzbranche und dem verarbeitenden Gewerbe kündigte der Premierminister bei seinem Amtsantritt im Jahr 2010 an. Eine Reaktion auf die Krisenjahre, die Großbritannien besonders hart trafen, weil das Land sich zu sehr auf die Finanzbranche als Wirtschaftsmotor verlassen hatte. Cameron legte einen Wachstumsplan vor: Investitionshilfen für Unternehmen, mehr Fachkompetenz, die Stärkung ausgewählter Produktionszweige und flexiblere Arbeitsmärkte sollten es richten. Doch geschehen ist seither kaum etwas.
Zwar gab die Regierung ein Gutachten in Auftrag, das den Bedarf an Investitionen für strukturschwächere Regionen ermittelte. Die Studie empfahl Ausgaben von 49 Millionen Pfund. Doch nur ein Sechstel der Summe hat sie bewilligt. Bei den Gewerkschaften stößt der Sparkurs auf Ablehnung. Das Wachstum der Industrie sei abgewürgt worden, sagt Clare Santry, Sprecherin des britischen Gewerkschaftsbunds TUC. Gerade der Export lahmt. TUC fordert deshalb verstärkte Investitionen in die Qualifikation von Beschäftigten, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Dem Vereinigten Königreich werden nach Angaben von TUC im Jahr 2020 rund 400 000 Ingenieure fehlen. Der Gewerkschaftsbund fordert auch eine Verdopplung der Investitionen für Innovationsförderung. „Nur 40 Prozent der britischen Produktionsfirmen investieren in Forschung und Entwicklung“, sagt Santry. In Deutschland seien es 70 Prozent. Der Blick auf den Kontinent freilich eint Cameron und TUC. Im vergangenen Februar kündigte der Premier für den Fall seiner Wiederwahl im Mai milliardenschwere Finanzhilfen für mittelständische Unternehmen an. Einiges davon dürfte in der Industrie landen. Immer wieder hatte Cameron in den vergangenen Jahren Deutschland als Vorbild genannt, wenn es um die Stärkung des produzierenden Gewerbes geht. Ob das Geld bei den Beschäftigten ankommt? Das wäre zu wünschen. Denn zwischen 2010 und 2014 sind die Reallöhne im verarbeitenden Gewerbe um 4,2 Prozent gesunken. Zudem kämpfen die Gewerkschaften gegen immer mehr „zero-hour contracts“. Durch sie können Arbeitgeber Beschäftigte ohne feste Arbeitszeiten anstellen. Binnen einen Jahres ist ihre Zahl um 19 Prozent auf nun knapp 700 000 angestiegen.
Fazit: Die Industrie wird sich ohne weitere Investitionen nicht von der Politik der vergangenen Jahrzehnte erholen. Wirtschaftsforscher des Instituts Cambridge Econometrics gehen davon aus, dass der Anteil des verarbeitenden Gewerbes weiter abnimmt.
Frankreich: Der Niedergang ist unübersehbar
Es sollte ein Zeichen sein. Im vergangenen Jahr verkündete der damalige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg die Gründung eines französischen Staatskonzerns – die erste seit 20 Jahren. Mehrere Hundert Millionen Euro sollen zwar weiterhin in das Bergbauunternehmen CMF fließen, doch kurz darauf gab es eine Regierungsumbildung. Jetzt ist das Projekt erst einmal auf die lange Bank geschoben. Montebourg erinnerte mit der neuerlichen Bildung eines Staatskonzerns an ein bewährtes Konzept aus erfolgreichen Nachkriegsjahren. Mit massiven Eingriffen in die Unternehmenslandschaft schuf die Politik damals Großunternehmen und damit Arbeitsplätze. Doch jetzt ist alles anders. Die Industrie ist im Niedergang begriffen. Frankreich hat kürzlich die Wachstumsprognosen für die Jahre bis 2017 nach unten korrigiert.
Der Grund: „Nahezu die komplette Wirtschaft stagniert wegen der beschleunigten Talfahrt der Industrie“, sagt Chris Williamson, Chefvolkswirt beim Wirtschaftsinformationsdienst Markit. Nach Regierungsangaben hat Frankreich in den vergangenen zehn Jahren 750 000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Präsident François Hollande will von oben gegensteuern. 2013 stellte er 34 Projekte vor, die der darbenden Industrie neues Leben einhauchen sollen, darunter Systeme zur Datensicherheit, ein Hochgeschwindigkeitszug, ein Gezeitenkraftwerk, ein Zwei-Liter-Auto, intelligente Netze. Doch die schützende Hand des Staates, wie man sie in Frankreich von den alten Staatsunternehmen kennt, werden die Arbeitnehmer nicht spüren, sollten dadurch überhaupt neue Arbeitsplätze entstehen.
Der Staat wolle derartige Projekte nicht mehr lenken, sondern begleiten, deutete Hollande an. Sein Wirtschaftsminister Emmanuel Macron konkretisierte: „Im Rahmen von einvernehmlichen Abkommen könnten Regeln für Arbeitszeit, Löhne oder Gehälter gelockert werden.“ Mittlerweile steht auch ein lascherer Kündigungsschutz auf dem Tableau. Einige Gewerkschaften haben bereits gegen die „marktgetriebene Industriepolitik“ demonstriert. Gebracht hat es nichts. Der Gewerkschaftsbund CFDT bemängelt vor allem die fehlende Innovationskraft der Industrie und fordert die Einbindung aller Sozialpartner für einen „qualitativen Dialog in Frankreich und in Europa“. Die Wettbewerbsfähigkeit habe zu lange auf verhältnismäßig geringen Arbeitskosten beruht, sagt Sprecherin Isabelle Poret. Dabei liegen die Arbeitskosten in unserem 5-Länder-Vergleich an der Spitze. Da ist viel zu tun, denn Innovationen lassen sich nicht verordnen. Ein fruchtbarer Dialog zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Politik findet unterdessen kaum statt.
Fazit: Der massive Eingriff in die Wirtschaft hat Tradition. Der Staat hält zahlreiche Beteiligungen an Großunternehmen – anders als in den meisten europäischen Staaten. Jetzt kehrt der Staat sich halbherzig davon ab, ohne dass die private Wirtschaft die Lücke füllen kann.
Italien: Strukturreformen sind überfällig
Wenn es um Italiens Industriepolitik geht, waren sich Arbeitgeber und Gewerkschaften ausnahmsweise lange einig: „Sie existiert nicht, aber wir brauchen sie“, äußerten sich sowohl der Chef des Industrieverbands Confindustria, Giorgio Squinzi, wie auch Metallgewerkschaftsboss Maurizio Landini noch im vergangenen Jahr öffentlich. Während sich Unternehmen vornehmlich über die überbordende Bürokratie im Lande beklagten und eine Lockerung des vergleichsweise strikten Kündigungsschutzes wünschten, erwartete die Arbeitnehmerseite staatliche Hilfen für die vielen schwächelnden Betriebe. Denn von der Krise hat sich Italiens kleinunternehmerisch geprägte Industrie bis heute nicht erholt. Rund 20 Prozent liegt die Industrieproduktion noch immer unter der aus dem Jahr 2008. Auch 2014 sank sie noch um ein knappes Prozent.
Heute liegt die Arbeitslosenquote bei 12,4 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit bei über 40 Prozent. Viele Experten machen dafür vor allem einen rigiden Kündigungsschutz verantwortlich. Lange konnten Firmen mit über 15 Mitarbeitern ihren Beschäftigten aus wirtschaftlichen Gründen kaum kündigen. Die Folge: Angst vor Neueinstellungen und massenhaft Betriebe, die ihr Wachstum zügelten, um unter dieser Marke zu bleiben. Tatsächlich besitzen viele Industriebetriebe in Italien nicht die Größe für eine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Daher konzentrieren sie sich auf den Binnenmarkt. Italiens Premier Matteo Renzi drückte schließlich Ende 2014 gegen den massiven Widerstand der Gewerkschaften eine Arbeitsmarktreform durch. Unternehmen sollen dadurch leichter kündigen und einstellen. Außerdem führt Renzi ein Arbeitslosengeld und eine Jobvermittlung ein. Gewerkschaften, allen voran die Metaller von FIOM-CGIL, kritisieren die Parlamentsbeschlüsse bis heute scharf. Sie fordern, vor allem jene Unternehmen finanziell zu unterstützen, die in Innovationen investieren. Denn da hat Italien massiven Nachholbedarf: Der Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt liegt bei nur 1,3 Prozent – nicht einmal die Hälfte dessen, was Deutschland dafür ausgibt.
Fazit: Die Lohnstückkosten sind seit der Jahrtausendwende um mehr als ein Drittel gestiegen, der Anteil der heimischen Industrie am Welthandel sinkt. Viele Betriebe sind kaum mehr wettbewerbsfähig. Ohne weitere Reformen wird die Industrie weiter an Boden verlieren.
Deutschland: Champion mit Schwächen
Zwischenzeitlich war die Industriepolitik in Deutschland nicht mehr als ein Museumsstück: ehemals bedeutend, aber bloß nicht anfassen. „Der Staat sollte sich so weit wie möglich aus Marktprozessen heraushalten“, schrieb das FDP-geführte Wirtschaftsministerium 2010. Eigentlich unverständlich. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Wiedervereinigung hatten staatliche Eingriffe maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland die europaweit stärkste Industrie aufbauen konnte.
Tatsächlich hat sich das Land deutlich schneller als andere europäische Staaten von der Finanzkrise der Jahre nach 2008 erholt. Verantwortlich dafür: eine starke Exportorientierung und Gewerkschaften, die krisenbedingte Entlassungen verhinderten. So blieb vielen Firmen das für diesen Standort so wichtige Fachwissen erhalten. Denn anders als andere Länder zeichnet sich die hiesige Industrie nicht nur durch einseitige Low- oder Hightech-Produktionen aus, sondern durch hochkomplexe Systemlösungen über lange Wertschöpfungsketten.
Darin liegt viel Potenzial. Doch Unternehmen haben zusehends Probleme, es auszuschöpfen. So ergab eine aktuelle Umfrage in der Chemiebranche, dass sich das Innovationsklima aus Sicht der Unternehmen seit 2009 verschlechtert. Auch die Qualität der Infrastruktur sehen Firmen und Industriegewerkschaften als zukünftig gefährdet an. Zudem beklagen Firmen hohe Energie- und Produktionskosten. Tatsächlich verlagern viele Arbeitgeber immer mehr Kapazitäten ins kostengünstigere Ausland. Deutschland ist exportabhängig – und je schwächer die Industrie in anderen Ländern wird, desto schwieriger könnte es werden, Verbündete für eine europäische Industriepolitik zu finden.
Schließlich konkurrieren neben Staaten wie China auch Länder wie die USA, die die weltweit wertvollsten Marken besitzen, mit Deutschland als Standort – befeuert durch eine starke Re-Industrialisierungspolitik. Diesen Trend hat nun auch die Bundesregierung aufgegriffen. Das „Bündnis für Industrie“ bedeutet einen neuerlichen Paradigmenwechsel: Der Staat, die Unternehmen und die Gewerkschaften wollen sich industriepolitisch abstimmen.
Fazit: Deutschland hat eine starke industrielle Basis, doch hat sich das Innovationsklima eingetrübt. Viele Firmen erhöhen ihre Produktionskapazitäten vor allem im Ausland. Damit Deutschland den Spitzenplatz behalten kann, sind ausreichende Investitionen in Forschung und Infrastruktur unabdingbar.
Polen: Gute Arbeit muss gesichert werden
Anders als in den meisten europäischen Ländern wächst die polnische Industrie und liegt – in Deutschland kaum bekannt – bei einem Anteil von etwa 23 Prozent des Bruttosozialprodukts. Fast jeder dritte Erwerbstätige arbeitet in diesem Wirtschaftszweig. Dabei ist seit dem Ende der 80er Jahre eine von der Regierung gelenkte Industriepolitik kaum zu erkennen – abgesehen von wenigen Positionspapieren und der Forderung an die EU über 700 Milliarden Euro für Investitionen in Osteuropa. Seit 1995 ruhen die Hoffnungen hauptsächlich auf den sogenannten Sonderwirtschaftszonen. Dort können sich auch ausländische Unternehmen steuerbegünstigt ansiedeln. Ein problematisches Modell in einer Wirtschaftsunion.
Tatsächlich sind so aber 250 000 Arbeitsplätze entstanden. Zu den größten Investoren zählen beispielsweise die Autobauer VW und Toyota. Die Autoindustrie zählt zu den wenigen Spitzentechnologien im Land. Den traditionell starken Branchen Maschinenbau, Lebensmittel- und Textilindustrie attestieren Experten hingegen Modernisierungsbedarf. Ersehnte Hightech-Arbeitsplätze erwartet die Regierung unter anderem ausgerechnet von einem altgedienten Wirtschaftszweig, der Kohleförderung. Die Hoffnung auf wirtschaftliche Effekte durch einen Technologievorsprung bei umweltschonender Kohleförderung fußt auf den führenden Forschungseinrichtungen im Land.
Für andere Hightech-Sektoren wie Elektronik, Biotechnologie und Luftfahrt verspricht der Staat bei Ansiedlungen Förderungen. Die Industrie wächst, doch die Qualität der Arbeit zieht vor allem bei weniger Qualifizierten nicht mit. Die regionalen Unterschiede sind groß. Schon im Jahr 2013 schickte der Gewerkschaftsbund Solidarnosz seine Mitglieder zum Protest gegen die zunehmende Verbreitung von Zeitarbeits- und Werkverträgen auf die Straße. Rund ein Drittel der polnischen Arbeitnehmer sind so beschäftigt, Tendenz auch in der Industrie steigend. Auch bei hoch Qualifizierten droht Ungemach. Das niedrige Lohnniveau und das Fehlen von Spitzentechnologien treibt sie zunehmend ins Ausland. Die Regierung muss jetzt gute Arbeit stärken.
Fazit: Die Attraktivität des Standorts fußt stark auf einem niedrigen Lohnniveau und auf dem unkomplizierten Zugang zu Rohstoffen. Eine Herausforderung besteht in der gezielten Förderung von Hochtechnologie.