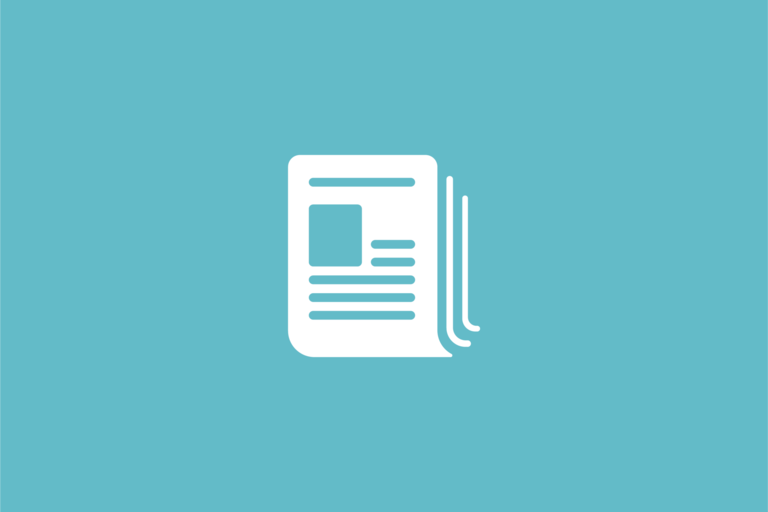: Oft gehört, trotzdem falsch
Viele Vorurteile in der Sozialpolitik halten einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. Von Andreas Schulte
Richtig ist:
Viele verzichten auf Geld, das ihnen zusteht.
In Deutschland Grundsicherung kassieren und im günstigeren Ausland leben – diesen Trick wandte im vergangenen Jahr offensichtlich ein Ehepaar aus Nigeria an. Bei einer Flughafenkontrolle flogen die beiden auf. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen verdonnerte sie zur Rückzahlung von 33.000 Euro an
Sozialleistungen. Das Paar habe sich ohne Genehmigung des Jobcenters im Ausland aufgehalten und daher dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung gestanden.
Fälle wie diese verbreiten, medial ausgeschlachtet, den Mythos von der „sozialen Hängematte“ in Deutschland. Doch die Wahrheit ist: Gerade einmal vier Prozent der Empfänger beziehen zu Unrecht Grundsicherung oder Arbeitslosengeld. So hat es die Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2022 dem ZDF berichtet.
Der volkswirtschaftliche Schaden hält sich in Grenzen. Und er liegt weit unter der Summe, die der Staat spart, weil Menschen auf Unterstützung verzichten. Denn ob aus Unwissenheit oder Scham, aufgrund sprachlicher Barrieren oder aus Scheu vor dem Gang zum Amt: Längst nicht jeder, der Anspruch auf Sozialleistungen hat, fordert sie auch ein, weiß Jennifer Eckhardt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Sozialforschungsstelle der Technischen Universität Dortmund: „Zwar kennen nur wenige ihren Anspruch gar nicht, aber viele verzichten bewusst und ziehen ein Leben in prekärer Lage den Begleitumständen des Hilfeempfangs vor.“
Ohnehin schaden andere Betrügereien dem Staat deutlich mehr. Steuerhinterziehung richtet beispielsweise einen größeren finanziellen Schaden an als Missbrauch bei Grundsicherung und Arbeitslosengeld. Am medialen Pranger und im politischen Diskurs steht dennoch zu oft der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen. So entsteht ein Zerrbild. „Es herrscht eine gesellschaftliche Empfänglichkeit für einfache Erklärungen. Der Ruf des Sozialstaats gerät dadurch in Gefahr“, sagt Eckhardt. Sie fordert eine regelmäßige staatliche Berichterstattung, die Quoten unrechtmäßig bezogener Leistungen ins Verhältnis zu anderen wirtschaftlichen Schäden durch Abgabebetrug setzt. Doch ein solches Zahlenwerk gibt es bislang nur ansatzweise in der Sozialberichterstattung, die üblicherweise zum Ende einer Legislaturperiode erscheint.
Richtig ist:
Krankheit ist kein Grund zu feiern.
Es stimmt: Beschäftigte in Deutschland fehlen heute wegen Krankheit länger und häufiger als früher. Für das Jahr 2024 verzeichnete die AOK im Herbst vergangenen Jahres 225 Krankmeldungen pro 100 Versicherte – nie waren es mehr.
Feiern die Deutschen häufiger krank? Ist es zu einfach, sich wegen eines Schnüpfchens vor der Arbeit zu drücken, etwa mithilfe der bequemen telefonischen Krankschreibung? Hält etwa das Wissen um die Lohnfortzahlung bei Krankheit die Beschäftigten unter der Bettdecke?
Eike Windscheid-Profeta widerspricht entschieden. Er leitet das Referat Wohlfahrtsstaat und Institutionen der sozialen Marktwirtschaft in der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. „Der Anstieg von Fehlzeiten hat vielfältige Gründe.“ Die wichtigsten: Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre kommen in ein Alter, in dem Menschen häufiger krank werden. Psychische Krankheiten werden erfasst und daher häufiger gemeldet. Krankschreibungen aus den Betrieben werden häufiger als früher den Kassen gemeldet. Und verbesserte medizinische Diagnosen entdecken mehr Krankheiten, was zu mehr Fehlzeiten führt. „Längere und häufigere Fehlzeiten erwecken den Eindruck, Beschäftigte würden sich leichtfertiger krankschreiben lassen als früher. Aber so ist es nicht“, sagt Windscheid-Profeta.
Längst nicht jedem Arbeitgeber scheinen diese Zusammenhänge bewusst zu sein. Hartnäckig hält sich das Gerücht, eine Beschränkung der Lohnfortzahlung könne die Krankenstände senken. Das Kalkül: Wird ein Arbeitstag nicht bezahlt, überlegt sich ein Beschäftigter genauer, ob er zur Arbeit erscheint. Doch dieser sogenannte Präsentismus, also die Erledigung von Arbeit trotz Krankheit, bewirkt genau das Gegenteil: „Präsentismus führt zu höheren Krankenständen“, sagt Windscheid-Profeta. „Womöglich beugt sich ein Beschäftigter dem Druck und erscheint am ersten unbezahlten Arbeitstag krank. Aber langfristig lohnt sich das für Arbeitgeber und Beschäftigte nicht.“
Eine Studie der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) geht von Folgekosten für Arbeitgeber aus, die jene der krankheitsbedingten Fehlzeiten weit übertreffen, denn kranke Beschäftigte machen Fehler, die Unfallgefahr steigt, es drohen Produktivitätsverluste und die Ansteckung von Kolleginnen und Kollegen. „Beschäftigte sollten vom ersten Krankheitstag an regenerieren, sonst drohen längere Ausfallzeiten“, sagt Windscheid-Profeta.
Richtig ist:
Wir können uns eine gute Rente für alle leisten.
Kaum hat sich die Boomer-Generation damit abgefunden, erst im Alter von 67 Jahren in Rente zu gehen, da denken einige Ökonomen und Arbeitgeber auch schon an die nächste Anpassung: Die Rente mit 70 soll her, fordert etwa Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf. Die Überlegung dahinter: Die Rente könne sich allein aus Beiträgen nicht finanzieren. Tatsächlich schießt der Bund jährlich Milliardenbeträge hinzu, unter anderem für Kindererziehung. Dieser Betrag belaste den Bundeshaushalt über Gebühr, monieren Kritiker. Hinzu kommt: Jetzt, mit dem bevorstehenden Renteneintritt der vielen Boomer, müssten immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentnerinnen und Rentner aufkommen. Das Renteneintrittsalter solle an die Lebenserwartung angepasst werden, empfiehlt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm.
Es lässt sich nicht verleugnen, dass Rentnerinnen und Rentner künftig aufgrund steigender Lebenserwartung länger Geld erhalten als frühere Generationen. Doch steigende Zuschüsse des Bundes an die Rentenversicherung als Beleg für ein schwächelndes Rentensystem anzuführen, ist falsch. Die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung sind keine kurzfristige Nothilfe, sondern waren bereits von Anfang an zur Finanzierung vorgesehen. Zwischen 2003 und 2021 stiegen sie von 77 Milliarden Euro jährlich auf 112 Milliarden Euro. Vergleicht man man sie mit der Beitragsentwicklung, ist ihr relativer Anteil seit den 1950er Jahren praktisch konstant geblieben.
Die relative Betrachtung der Zahlen entkräftet auch das Argument, die Milliardenzuschüsse zur Rente würden den Bundeshaushalt überstrapazieren. Denn seit 2004 ist der Anteil der Bundeszuschüsse an den Einnahmen des Bundeshaushalts sogar gesunken – ausgenommen die Coronajahre. Ingo Schäfer, Leiter des Referats Alterssicherung und Rehabilitation beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), kann, bezogen auf den Bundeshaushalt, keine Überlastung erkennen: „Offensichtlich sind die vielfachen Behauptungen zu explodierenden Bundeszuschüssen falsch.“
Ohnehin bewegen sich die Befürworter eines späteren Renteneintritts auf dünnem Eis, denn das jeweils aktuelle durchschnittliche Renteneintrittsalter der Menschen in Deutschland können sie kaum benennen. Die Rentenversicherung vermag dies in ihren jährlichen Statistiken nicht einmal selbst. „Die Herangehensweise der deutschen Rentenversicherung an diese Berechnung ist mathematisch unglücklich und daher ungeeignet“, sagt die Soziologin und Datenanalystin Dagmar Pattloch.
Sie nennt drei Kritikpunkte: Die Rentenversicherung lege ihren Berechnungen keine Nachkommastellen zugrunde. In die Analyse fließen Altersangaben von Menschen zum Beispiel von 63 oder 64 Jahren ein, nicht aber von 64,1 oder 64,9 Jahren. Zweitens berücksichtigt die derzeitige Methode nicht die sich wandelnde Altersstruktur der Bevölkerung. Und schließlich liegen der aktuell üblichen Berechnung nur Renteneintritte eines einzelnen Jahres zugrunde, was einen Zeitvergleich nutzlos macht. Für jeden Geburtsjahrgang ändert sich nicht nur die Altersstruktur, sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Folge ist ein verfälschtes Ergebnis.
Beide Effekte sind voneinander nicht zu trennen. Die Datenexpertin schlägt eine Darstellung vor, die das durchschnittliche Alter beim Renteneintritt für die jeweiligen Geburtsjahrgänge von Neurentnern berichtet.
Richtig ist:
Wenn die Arbeit nicht kaputtmacht, kehren viele Pflegekräfte in den Beruf zurück.
Der Begriff ist so alt und gebräuchlich, dass er kaum mehr infrage gestellt wird: Der „Pflegenotstand“ zeichnet bereits seit den 1960er Jahren das Bild von vernachlässigten Heimbewohnern, überlasteten Beschäftigten und finanziell gebeutelten Pflegebedürftigen. Die Pflege stünde „am Abgrund“ titelte die Zeitung Merkur noch im Herbst vergangenen Jahres. Michaela Evans-Borchers, Direktorin des Forschungsschwerpunkts Arbeit & Wandel am Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, kennt diese Prognosen: „Es wirkt manchmal, als sei der sogenannte Pflegenotstand eine unausweichliche Katastrophe. Aber, so ist es nicht.“
Fakt ist: Laut dem Statistischen Bundesamt werden im Jahr 2049 zwischen 280 000 und 690 000 Pflegekräfte fehlen. „Das ist eine der größten sozialen Herausforderungen unserer Zeit“, sagt Evans-Borchers. Auf der anderen Seite stehen bis zu 660 000 Vollzeitpflegekräfte in Deutschland zusätzlich zur Verfügung, entweder durch die Rückkehr in den Beruf oder die Aufstockung der Arbeitszeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2022, an der Evans-Borchers beteiligt war. Das Papier schränkt allerdings ein, dass sich dazu die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich verbessern müssen. Zur Finanzierung des zusätzlichen Personals schlägt die Studie zum Beispiel eine Bürgerversicherung vor.
Die Studie fragte auch ab, welche Arbeitsbedingungen Pflegeberufe attraktiver machen. Einige der wichtigsten: Mehr Zeit für eine qualitativ hochwertige Pflege, eine angemessene Bezahlung, verbindliche Dienstpläne und weniger Dokumentation.
Die alleinige Stellschraube zur Verbesserung der Pflege gibt es also nicht. Pauschale Formulierungen verkennen, dass sich die Bedingungen für Pflegearbeit von Sektor zu Sektor stark unterscheiden, etwa bei der Finanzierung im Krankenhaus, in der ambulanten Versorgung oder in Hospizen. „Die“ Pflege gebe es nicht, sagt Evans-Borchers. Sie sieht daher nicht nur die Politik in der Pflicht. Es gebe Gestaltungsmöglichkeiten für alle Beteiligten aus Politik, Unternehmen und Arbeitnehmervertretungen. „Wir müssen einen Verantwortungsmix verinnerlichen“, sagt sie.
Für die Zukunft sieht sie drei mögliche Szenarien, insbesondere für die Langzeitpflege. Erstens: eine schleichende Rückverlagerung von noch mehr Pflege in die Familien. Zweitens: eine Umverteilung des knappen Pflegepersonals zwischen attraktiven und weniger attraktiven Regionen und Einrichtungen. Und drittens: eine flächendeckende Aufwertung der Pflege, unter anderem mit einer auskömmlichen Finanzierung, attraktiven Arbeitszeitmodellen und einer Digitalisierung, die Entlastung schafft. „Ich bin Optimistin und glaube an Szenario drei“, sagt Evans-Borchers.
Richtig ist:
Wenn sich Arbeit nicht lohnt, sind die Löhne zu niedrig.
Ein Wortungetüm befeuerte nicht nur im vergangenen Jahr die Debatte um soziale Gerechtigkeit: Politiker sahen einmal mehr das sogenannte „Lohnabstandsgebot“ gefährdet, als zu Beginn des Jahres das Bürgergeld um 61 Euro auf 563 Euro pro Monat erhöht wurde. Das Mantra der überwiegend konservativen Kritiker: Wenn das Bürgergeld so hoch ist, dann lohnt sich Arbeit nicht mehr, dann legen sich die Bürger auf die faule Haut und nutzen die Sozialsysteme aus.
Jutta Schmitz-Kießler, Professorin für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Sozialpolitik an der Hochschule Bielefeld, hält dagegen: „Wissenschaftler haben bereits mehrfach ausgerechnet, dass sich Arbeit im Vergleich zur Grundsicherung immer auszahlt. Wenn Einzelfälle einen gegenteiligen Eindruck erwecken, sind sie meist konstruiert.“
Dennoch kochte die Debatte gerade nach den vorerst letzten beiden Bürgergelderhöhungen wieder einmal hoch. Verglichen mit den vorangegangenen Erhöhungen fielen sie relativ hoch aus. „Viele Kritiker verkennen, dass die Anpassungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Nettolöhnen und Verbraucherpreisen zu sehen sind“, sagt Schmitz-Kießler. Faktisch ist die Erhöhung der Grundsicherung bis zum Jahr 2023 mit 46 Prozent seit 2005 deutlich hinter den Nettolöhnen zurückgeblieben, die um 59 Prozent anstiegen. Erst mit der Anpassung des Jahres 2024 zog die Erhöhung der Grundsicherung mit der Entwicklung der Nettolöhne in etwa gleich. Hinzu kommt: „Die im Vergleich zu den Vorjahren starke Erhöhung aus 2023 und 2024 ist vor allem der zuvor hohen Inflation geschuldet“, sagt Schmitz-Kießler.
Ohnehin darf das Argument nicht gelten, demzufolge sich Arbeit angesichts hoher Bürgergeldsätze nicht mehr lohne, denn das Bürgergeld muss laut Verfassung die Existenz von Bürgern sichern. „Welcher Abstand zu Löhnen besteht, ist für die Berechnung unerheblich“, sagt Schmitz-Kießler.
Die Professorin sieht in der oft geforderten Einfrierung der Bürgergeldsätze Populismus. „Das ist eine politische Strategie für mehr Wählerstimmen.“ Sie fordert den Dreh an einer anderen Stellschraube: „Wir kommen an fairen Löhnen, guten Arbeitsbedingungen und einer angemessenen Umverteilung nicht vorbei.“