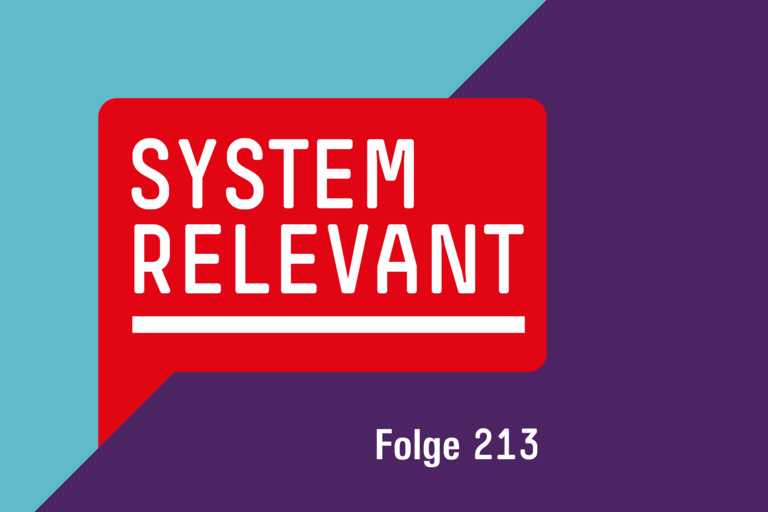: Mehr Europa, aber anders!
KRISENDYNAMIK Die wirtschaftspolitischen Konstruktionsfehler der EU müssen korrigiert werden – und damit das System der Wettbewerbsstaaten, das die Lohn- und Steuerpolitiken massiv unter Druck gesetzt hat. Eine alternative Wachstums- und Schuldenpolitik könnte die Eurokrise überwinden. Von Klaus Busch
Von Klaus Busch, emeritierter Professor für Europäische Studien an der Universität Osnabrück und europapolitischer Berater der Gewerkschaft ver.di/Foto: Aristidis Vafeiadikis
Die EU befindet sich in einer tief greifenden Malaise. Seit zwei Jahren steht der Euro am Rande des Scheiterns. Die harte Sparpolitik hat die Eurozone in die Rezession befördert mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote in der EU von über zehn Prozent. Und mit einer dramatischen Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland von mehr als 50 Prozent.
Insgesamt ist durch die Finanz- und die Eurokrise eine Situation entstanden, in der es für die Linke in Europa keine Alternative zur Strategie des „Mehr Europa, aber anders“ gibt. Wir sollten nicht die weitere Abgabe von nationalen Kompetenzen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ablehnen und dabei funktional notwendige Schritte zur Komplettierung der europäischen Wirtschaftspolitik blockieren, weil uns der derzeit neoliberale politische Kurs von Kommission, Rat der Union und Europäischem Rat nicht gefällt – wie das Martin Höpner in seinem Beitrag in der Mitbestimmung nahelegt. In Deutschland treten wir auch nicht für eine Verlagerung der Wirtschaftspolitik auf die Ebene der Bundesländer ein, nur weil eine schwarz-gelbe Bundesregierung eine neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgt.
Wir kommen in Europa nur nach vorne, wenn wir zwei Aufgaben anpacken: einerseits den neoliberalen Diskurs durchbrechen und neue politische Mehrheiten für einen alternativen Politikansatz gewinnen. Andererseits müssen wir die institutionellen Defizite des Maastrichter Vertrages – des Gründungsvertrages der EU von 1992 – durch weitere Integrationsschritte überwinden. Von den Mängeln des Maastrichter Vertrages lässt sich eine direkte Verbindungslinie zu den heutigen Problemen der Eurozone ziehen. Die dort konzipierte Wirtschafts- und Währungsunion, WWU, ist nicht in einen europäischen Bundesstaat, eine politische Union, eingebettet worden. Und der Euro ist nicht in einer echten politischen Solidargemeinschaft verankert worden. Damit fehlen in der EU Finanzausgleichsmechanismen zwischen ungleich entwickelten Staaten. Diesem Konstruktionsmangel ist es geschuldet, dass die EU die Eurokrise Anfang 2010 nicht sofort durch die Erklärung beenden konnte, alle Mitgliedstaaten stünden für die Schulden Griechenlands gerade. Ebenso liegt es in diesem Defizit des Maastrichter Vertrages begründet, dass die Eurostaaten nicht gemeinsame Staatsanleihen – Eurobonds – auflegen, was die verschuldeten Staaten an der Zinsfront sehr entlasten würde.
Darüber hinaus ist die Wirtschafts- und Währungsunion asymmetrisch konstruiert. Die EU-Verträge sehen zwar eine Europäisierung der Geldpolitik vor, die Finanzpolitik ist jedoch im Wesentlichen in den Händen der Mitgliedstaaten verblieben. Dieses Defizit hatte zur Folge, dass einige der schwächer entwickelten Eurostaaten aufgrund der niedrigen Zinsen im Euroraum einen Investitions- und Konsumboom erlebten, dessen Exzesse jedoch nicht durch eine europäische Fiskalpolitik unterbunden werden konnten. So verzeichneten Irland und Spanien eine Immobilienblase, die in der Krise platzte. Die daraufhin notwendigen Staatseingriffe zur Rettung der Banken trieben die an sich sehr niedrigen Staatsschuldenquoten beider Länder in die Höhe. Eine supranationale europäische Wirtschaftsregierung hätte diese Fehlentwicklungen unterbinden können, indem sie beiden Ländern eine kontraktive Fiskalpolitik verordnet hätte, um den zinsbedingten Boom zu dämpfen. Ebenso hätte diese supranationale europäische Wirtschaftsregierung in Griechenland dafür sorgen können, dass im Zuge der hohen Wachstumsraten des Landes eine konsolidierende Haushaltspolitik darauf hinarbeitet, die Staatsschuldenquote zu senken. Stattdessen haben auch hier die niedrigen Eurozinsen die Wirtschaft stark stimuliert, ohne dass die Regierungen Griechenlands den Haushalt in Ordnung gebracht haben. Dann hätte die Weltfinanzkrise nicht so verheerende Wirkungen gehabt.
Die supranationale Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bedarf zwingend der Ergänzung durch eine supranationale europäische Wirtschaftsregierung, um solche Fehlentwicklungen verhindern zu können. Auch zur Bekämpfung von Wirtschaftskrisen ist eine Europäisierung der Fiskalpolitik erforderlich, weil sonst die einzelnen Mitgliedstaaten jeder für sich handeln und eine konsistente antizyklische Politik nicht ohne Weiteres zustande kommt.
Ein zusätzliches Manko des Maastrichter Vertrages besteht in der neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, die dem Sparen den Vorrang vor Wachstum gibt. Diese ideologische Ausrichtung wirkt bis heute fort, sie hat die EU-Politik in der Eurokrise dominiert und Europa letztlich in eine Rezession getrieben. Der Maastrichter Vertrag enthält zwar keine Bestimmungen über eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, er hat dennoch die Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten einseitig auf das Schuldenproblem fixiert. Bis zur Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise 2008/2009 haben sich diese Bestimmungen nicht als größeres Problem erwiesen. Viele Staaten konnten ihre Staatsverschuldung durch starkes wirtschaftliches Wachstum und hohe Steuereinnahmen deutlich zurückfahren. Durch die Krise sind jedoch in vielen Staaten die Schulden geradezu explodiert.
Dennoch wären die Probleme der Staatsverschuldung in der EU lösbar gewesen, wenn es nicht zu einer Verkehrung von Ursache und Wirkung der Schuldenkrise gekommen wäre. Der Öffentlichkeit wurde suggeriert, dass nicht die Wirtschaftskrise die Schuldenexplosion erzeugt hat, sondern umgekehrt die Schulden die Krise verursacht haben. Doch ohne das Eingreifen der Staaten zur Rettung der Konjunktur und der Finanzwelt würden wir uns heute in einer noch tieferen Krise befinden. Dennoch werden die notwendigerweise entstandenen Staatsschulden verteufelt. Die Schuldner – und nicht die Finanzwelt – sind die Schuldigen, und die Schulden gelte es zu senken, komme, was wolle.
In der Eurokrise hat dieses Denken dazu geführt, dass die Stützungskredite für Griechenland, Irland und Portugal mit strikten Auflagen zur Senkung der Staatsschulden verknüpft worden sind. Mehrwertsteuererhöhungen, Entlassungen im öffentlichen Dienst, Kürzungen der Löhne und Sozialleistungen und Erhöhungen des Renteneintrittsalters sind die Instrumente dieser Politik. Die Opfer der Krise müssen jetzt auch noch die Hauptlasten bei der Bewältigung der Staatsschulden tragen. Dieser Politik wird bis weit hinein in die Sozialdemokratie in Europa Beifall gezollt. Dabei löst sie die Probleme nicht. Im Gegenteil, das Wirtschaftswachstum wird in diesen Ländern durch die kurzfristige und kurzsichtige Konsolidierungspolitik abgewürgt, und die Schuldenquoten steigen weiter an.
Dieser Politikansatz wird aber nicht nur in Irland, Portugal und Griechenland verfolgt, nein, in allen Staaten, die vermeintlich zu hohe Schuldenlasten tragen, erzwingen die Finanzmärkte und die Europäische Kommission weitere Spareinschnitte. Dass sich Europa derzeit in einer Rezession befindet, ist nicht verwunderlich, sondern Ergebnis dieses falschen wirtschaftspolitischen Ansatzes. Schlimmer noch: Die EU lernt aus diesen Fehlern nicht, sondern hat die Politik des Sparprimats noch verstärkt. Die Verschärfung des Stabilitätspakts im Sixpack sowie der von Merkozy durchgedrückte Fiskalpakt samt Schuldenbremse zeugen von dieser mangelnden Lernfähigkeit des konservativ-liberalen Mainstreams.
Schwer wiegt auch, dass mit dem Maastrichter Vertrag ein System von Wettbewerbsstaaten in der EU eingeführt wurde. Wir haben eine gemeinsame Währung und einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt, aber die Löhne, die Sozialausgaben und die Steuern werden weiterhin national bestimmt. In einem solchen System geraten die Löhne, Sozialausgaben und Steuern in einen Sog nach unten, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit bei einer einheitlichen Währung zu steigern. Wir beobachten deshalb, dass es den Gewerkschaften in Europa mit ganz wenigen Ausnahmen nicht mehr gelungen ist, die Reallohnzuwächse am Anstieg der Produktivität zu orientieren. Überall ist eine dramatische Umverteilung von unten nach oben, zugunsten der Kapitaleigentümer zu beobachten. Und dies seit nunmehr 15 bis 20 Jahren. Am tollsten hat es Deutschland getrieben. Hier sind die Reallöhne am stärksten abgebaut worden. Die Folge sind große Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands, vor allem im Handel mit seinen EU-Partnerländern. Wir importieren auf diese Weise Beschäftigung und exportieren Arbeitslosigkeit. Auf die Kritik der ehemaligen Finanzministerin Lagarde an dieser deutschen Art, sich Vorteile zu verschaffen, antwortete Frau Merkel: Leistungsbilanzen seien auch Leistungszeugnisse, die anderen europäischen Staaten sollten sich ein Beispiel an Deutschland nehmen. Genau diese Logik des Systems der Wettbewerbsstaaten ist die Logik des Euro-Plus-Paktes. Die anderen Euro- und EU-Staaten sollen dem deutschen Weg des relativen Lohnabbaus folgen und der deutschen Sozial- und Rentenpolitik nacheifern. Dadurch werden aber nicht nur die europäischen Lohn-, Sozial- und Steuerstandards unter die Räder geraten, auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wird einbrechen – mit deflatorischer Tendenz. Wie sollten wir auf diese Malaise des europäischen Integrationsprozesses reagieren? Entweder wir kehren zu nationalen Währungen zurück, oder wir vertiefen den Integrationsprozess und überwinden dabei die Defizite des Maastrichter Vertrages. Den von Martin Höpner vorgeschlagenen „aufgeklärten Protektionismus“ halte ich nicht für eine konsistente Alternative. Er will weder den Weg zurück zu den nationalen Währungen gehen, was konsequent wäre, noch den Weg vorwärts zu einer Stärkung des ökonomischen, sozialen und politischen Integrationsprozesses beschreiten, der die von ihm zu Recht bemängelten Defizite der momentanen EU überwinden würde. Seine Vorschläge für die Entsenderichtlinie, den Schutz der Mitbestimmung und des nationalen Arbeitsrechts sind sinnvoll. Sein Weg des „aufgeklärten Protektionismus“ ist aber auf die Kernfelder der Wirtschafts-, Lohn-, Sozial- und Steuerpolitik nicht anwendbar. Wie sollte eine nationale protektionistische Wirtschaftspolitik im Rahmen der Eurozone aussehen? Höpner beklagt das autoritäre Regime der intergouvernementalen europäischen Wirtschaftsregierung, diskutiert aber keine Alternativen. Bei der Spaltung von einerseits europäischer Geldpolitik und andererseits nationaler Fiskalpolitik zu bleiben ist keine Lösung, sondern Teil des Problems. Auch ließe sich eine progressive nationale Lohn-, Sozial- und Steuerpolitik in der Eurozone nicht durchhalten. Mitgliedstaaten, die diesen Weg versuchten, würden ökonomisch abgestraft werden. Zwar wäre eine Rückkehr zu den nationalen Währungen möglich, sie birgt aber sehr hohe Anpassungskosten sowie die Gefahr eines Zusammenbruchs des europäischen Integrationsprozesses. Die Währung Deutschlands würde stark aufwerten, diejenige der Südstaaten sehr stark abwerten, Anpassungskrisen hier und dort wären die Folge. Während Deutschland in einer Übergangszeit mit Export-, Wachstums- und Beschäftigungseinbrüchen zu kämpfen hätte, würden die Südstaaten mit hohen Zinslasten und Staatsinsolvenzen zu tun haben, ihr Einkommen würde in der Anpassungsphase stark sinken. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden diese Krisen auch den einheitlichen Binnenmarkt in Mitleidenschaft ziehen und neue Protektionismen auf den Plan rufen. Ob der europäische Integrationsprozess diesen Belastungen standhalten würde, muss bezweifelt werden. Alles in allem wäre dies ein Weg, den wir aus ökonomischen, sozialen und politischen Gründen nicht beschreiten sollten.
Dagegen plädiere ich für „Mehr Europa, aber anders!“ – als Weg, der die Defizite des Maastrichter Vertrages wie etwa die Asymmetrie der wirtschaftspolitischen Konstruktion überwindet. Eine europäische Wirtschaftsregierung könnte in der Eurozone eine flexible Stabilisierungspolitik betreiben und ökonomische Exzesse wie vor der Krise in Spanien, Irland und Griechenland vermeiden. Diese Wirtschaftsregierung müsste – auf dem Weg zum europäischen Bundesstaat – demokratisch legitimiert werden.
Das System der Wettbewerbsstaaten würde durch eine Koordinierung der Lohn-, Sozial- und Steuerpolitiken auf der europäischen Ebene ausgehebelt. Die Löhne würden sich an der Marge aus nationalen Produktivitätszuwächsen und Inflationsrate orientieren, womit sowohl der Prozess der Umverteilung von unten nach oben wie der innereuropäischen Wettbewerbsverzerrungen beendet wäre. Die wohlfahrtsstaatlichen Politiken würden sich im Sinne des Korridormodells an der ökonomischen Leistungsfähigkeit der Nationalstaaten orientieren, womit der Prozess des Sozialdumpings gestoppt wäre. Das Dumping in der Steuerpolitik würde durch einheitliche europäische Bemessensgrundlagen und einheitliche Unternehmenssteuersätze beendet. Die Eurokrise würde in diesem Modell durch eine alternative Wachstums- und Schuldenpolitik überwunden werden. Ein Marshallplan für Südeuropa, eine Stimulierung der deutschen Wirtschaft durch eine Förderung des Binnenmarkts sowie eine Beendigung der krisenverschärfenden Austeritätspolitik der Troika wären die drei Komponenten der alternativen Wachstumsstrategie für Europa. Darüber hinaus würde ein europäisches Management der Staatsschulden mit gemeinsamen Garantien und Eurobonds die Zinslast der überschuldeten Staaten senken. Durch höheres Wachstum und niedrigere Zinsen würden die Schuldenquoten der Südstaaten sinken.
Mehr Informationen
Klaus Busch: Scheitert der Euro? Strukturprobleme und Politikversagen bringen Europa an den Abgrund. FES-Studie, Februar 2012
Klaus Busch/Dierk Hirschel: Europa am Scheideweg – Wege aus der Krise. FES-Studie, März 2011