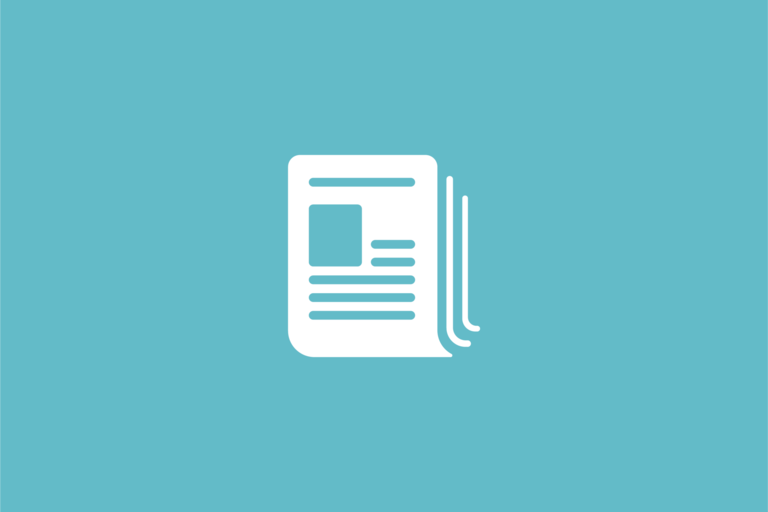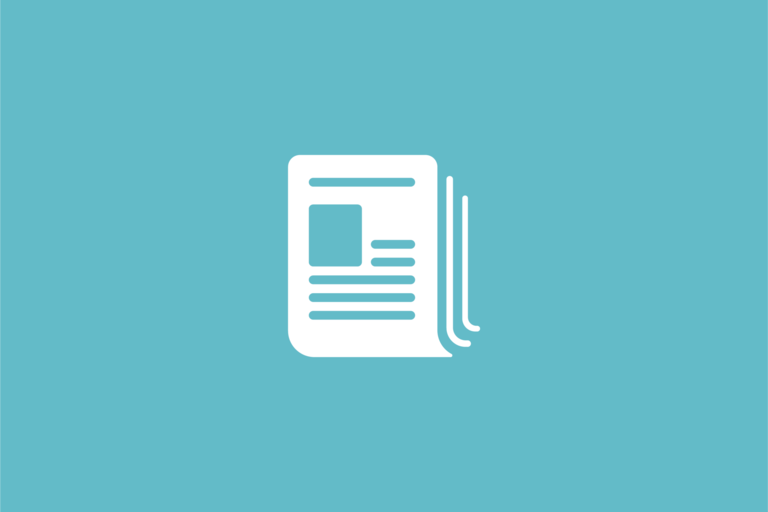: INTERVIEW 'Politische Streiks sind für uns kein Tabu'
Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di, über die chronische Unterfinanzierung der Kommunen, höhere Steuern für Kapitalbesitzer und den politischen Kurs der Bundesregierung.
Das Gespräch führten GUNTRAM DOELFS, MARGARETE HASEL und KAY MEINERS./Foto: David Ausserhofer
Herr Bsirske, mit der Kampagne "Gerecht geht anders" probt ver.di gerade den Schulterschluss mit den Kommunen. Gleichzeitig hat die Gewerkschaft im Frühjahr einen Tarifabschluss durchgesetzt, der vielen Kommunen schwer auf dem Stadtsäckel liegt. Wie ist das Klima unter den neuen Bündnispartnern?
Es gibt eine ausgeprägte Kooperationsbereitschaft. Das verwundert nicht, schließlich haben wir beim Thema Finanzausstattung der Kommunen überwiegend gemeinsame Interessen. Wir müssen die Handlungsfähigkeit der Kommunen erhalten, das dient dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Kommunen sind systemrelevant für den Sozialstaat.
Ist der Bund nun der gemeinsame Gegner? Dieser hat durch seine Sozialgesetzgebung den Kommunen erhebliche Lasten aufgebürdet.
Durch die Steuergesetzgebung der letzten Jahre sind den Kommunen insgesamt acht Milliarden Euro an jährlichen Einnahmen verloren gegangen. Diese falsch angelegte Steuerpolitik hat die öffentlichen Haushalte ausgezehrt. Wenn wir die Handlungsfähigkeit der Kommunen auf Dauer sichern wollen, brauchen wir entschiedene Weichenstellungen des Gesetzgebers. Ich denke da zum Beispiel an den Erhalt und die Stärkung der Gewerbesteuer, die in der Regel die Haupteinnahmequelle der Kommunen darstellt.
Die Kommunen sind pleite, die Schuldenbremse begrenzt die Möglichkeit, auf Pump zu investieren. Brauchen wir nicht eine schonungslose Debatte darüber, welche Aufgaben die öffentliche Daseinsvorsorge zukünftig noch übernehmen kann?
Diese Debatte wird bereits seit Jahrzehnten geführt. Dabei hat sich herausgestellt, dass es falsch ist, das Problem von der Kostenseite her anzugehen. Städte wie Recklinghausen, Duisburg oder Offenbach könnten alle freiwilligen Leistungen einstellen und ihr gesamtes Personal entlassen und würden trotzdem auf Jahre nicht aus den roten Zahlen herauskommen. Es gibt kein Ausgabenproblem in den Gemeinden, sondern ein Einnahmeproblem. Hier muss angesetzt werden, indem die starken Schultern in der Gesellschaft sehr viel stärker als heute zur Finanzierung der Zukunftsausgaben herangezogen werden.
Sie haben erklärt, dass sonst auch in Deutschland griechische Verhältnisse drohen. Was genau haben Sie damit gemeint?
Die kommunale Finanzkrise wird sich zuspitzen. Ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, was dann passiert. Neben weiteren Einsparungen bei den Investitionen führt das vor allen Dingen auch zu Einsparungen und Kürzungen beim kommunalen Finanzausgleich. Damit geraten die kommunalen Finanzen zusätzlich unter Druck. Vor allem in den neuen Bundesländern, die noch viel mehr auf Zuweisungen der Bundesländer angewiesen sind als die westlichen.
Kann man Deutschland und Griechenland auf diese Weise vergleichen? Griechenland gilt als hoch korrupt, die Steuermoral ist äußerst schlecht, und es gibt doppelt so viele Beamte pro Einwohner wie in Deutschland. Die Ausgaben sind völlig aus dem Ruder gelaufen.
Natürlich gibt es hausgemachte Probleme in Griechenland. Aber wir haben auch in Deutschland ein Steuervollzugsdefizit. Nach Auffassung des Arbeitskreises der Finanzministerien, der die aus Arbeitgebersicht notwendige Personalausstattung ermittelt hat, fehlen bundesweit 5000 bis 6000 Steuerfahnder. Und das, obwohl alle wissen, dass jeder Betriebsprüfer im Jahr eine Million Euro und mehr einbringt - nach Abzug seiner Gehaltskosten. Auf rund fünf bis sechs Milliarden Euro wird also allein durch die personelle Unterbesetzung der Finanzbehörden verzichtet - das geht zugunsten der Unternehmen. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir steuern auf griechische Verhältnisse zu, wenn Einrichtungen schließen, Personal abgebaut wird und der Druck auf die Löhne steigt.
Der Verwaltungswissenschaftler Lars Holtkamp schätzt, dass etwa 30 Prozent der Defizite in den Kommunen auf Missmanagement und unsinnige Großprojekte zurückzuführen sind. Muss eine Organisation wie ver.di nicht beide Seiten der Bilanz ins Auge fassen?
Nichts anderes machen wir. Zum täglichen Brot der Vertrauensleute und der Personalräte vor Ort gehört die Auseinandersetzung mit der Frage, an welchen Stellen es sinnvolle Einsparmöglichkeiten gibt. Das ändert nichts daran, dass wir an einem Punkt sind, an dem es in erster Linie darum gehen muss, die Einnahmen der Kommunen zu verstetigen und zu erhöhen.
Viele Kommunen nutzen ihre Einnahmemöglichkeiten nicht aus. Im Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen liefern sie sich untereinander bei der Gewerbesteuer einen harten Wettkampf um günstige Hebesätze und langjährige Steuerbefreiungen.
Ich will nicht in Abrede stellen, dass es in der einen oder anderen Stadt noch Potenzial beim Hebesatz gibt. Für viele klamme Kommunen gilt das aus meiner Sicht jedoch nicht. Da liegen die Sätze schon bei 400 oder 500 Punkten. Das ist das obere Ende dessen, was angesichts der Standortkonkurrenz machbar ist. Aber Gewerbesteuerhebesätze haben nur eine nachrangige Bedeutung für Ansiedlungsentscheidungen. Viel wichtiger ist das Angebot an Fachkräften, die Verkehrsinfrastruktur oder die Verfügbarkeit von attraktiven Flächen.
ver.di möchte die Gewerbesteuer erweitern und alle Selbstständigen und Freiberufler zur Gewerbesteuer heranziehen. Wie viel käme dadurch in die Kassen?
Bei Ärzten, in Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien gibt es Gewinne und Einkommen, die sich mit denen von mittelgroßen Firmen vergleichen lassen. Freiberufler profitieren von der Infrastruktur genauso wie Firmen. Hier muss das Band zwischen denen, die von der kommunalen Infrastruktur profitieren, und jenen, die dafür aufkommen, neu geknüpft werden.
Sie zeichnen hier das Klischeebild des gut verdienenden Selbstständigen oder Freiberuflers. Die Realität sieht heute für junge Architekten, Journalisten und unfreiwillig Selbstständige anders aus. Monatseinkommen von 1200 Euro sind da keine Seltenheit.
Deswegen wird man mit Freibeträgen arbeiten müssen, die den Kreis derer, die Gewerbesteuer zahlen sollen, auf diejenigen beschränkt, welche das von der ökonomischen Seite her auch tragen können.
Die Gewerbesteuer war in früheren Jahrzehnten nicht so konjunkturanfällig, weil es eine Gewerbekapitalsteuer und eine Lohnsummensteuer gab. Möchte ver.di dahin zurück?
Das wäre wenig realistisch. Wir machen diese Steuer schon konjunkturunabhängiger, sofern wir die genannten Berufe gewerbesteuerpflichtig machen. Die konjunkturelle Anfälligkeit von Ärzten ist nicht so ausgeprägt wie die mancher Industrien. Insofern gibt es ein Verstetigungsmoment durch die breitere Basis. Der Weg, den die Bundesregierung eingeschlagen hat, ist dagegen völlig kontraproduktiv.
Sie meinen die Pläne, die Gewerbesteuer abzuschaffen und aufkommensneutral mit höheren Anteilen an der Einkommenssteuer zu kompensieren?
Genau. Und durch erhöhte Mehrwertsteuereinnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise. Der Auftrag der Gemeindefinanzkommission lautet, eine aufkommensneutrale Reform vorzuschlagen, bei der die Anteile zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nicht umgeschichtet werden. Wenn die Einnahmen der Kommunen aus der Mehrwertsteuer steigen sollen, geht das nur über eine Anhebung dieser Steuer. Das wäre aber eine Umverteilung der Lasten - weg von den Unternehmen, hin zu den Bürgern.
ver.di fordert eine Art Bad Bank für die kommunalen Schulden, um Städte und Gemeinden langfristig zu entlasten. Wer soll zahlen?
Wir brauchen eine Unterstützung der Kommunen beim Zinsdienst, da sind die Länder und der Bund gefordert. Es ist daher ein Unding, dass keine Vermögenssteuer mehr erhoben wird und wir uns einen Zustand leisten, in dem die Bundesrepublik eine Steueroase für Menschen mit großen Erbschaften und Vermögen ist. Hinzu kommt, dass der Bund in den vergangenen zehn Jahren Unternehmen und hohen Einkommen steuerliche Entlastungen von rund 300 Milliarden Euro gewährt hat. Die Zeche dafür wird von den Bürgern und den Kommunen gezahlt. Sie nehmen Kassenkredite auf, um den Solidarausgleich Ost überhaupt finanzieren zu können, und geben das Geld eins zu eins in die neuen Bundesländer weiter.
Wie hoch schätzt ver.di aktuell die Summe ein, die sich mit einer wiedereingeführten Vermögenssteuer und einer Erhöhung der Erbschaftssteuer erzielen ließe?
Wenn wir das entsprechende Steuerniveau auf den Durchschnittssatz der 15 alten EU-Mitgliedstaaten anheben würden, könnten wir jährlich 29 Milliarden Euro Mehreinnahmen erzielen.
Kritiker sagen, damit erreiche man nur eine Kapitalflucht ins Ausland, ganz zu schweigen von den kontrovers diskutierten verfassungsrechtlichen Problemen.
Deswegen flieht das Kapital ja auch so massiv aus Frankreich, Großbritannien, den USA und diversen anderen Ländern, die alle eine deutlich höhere Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung haben als wir. Diese ironische Bemerkung sei gestattet. Wir haben es mit einer verzerrten Wahrnehmung zu tun. Wenn man in Deutschland eine Umfrage unter den Menschen starten würde, wo wir denn im internationalen Vergleich von Industriestaaten bei der Besteuerung stehen, bin ich mir relativ sicher, dass sehr viele uns am oberen Ende verorten würden. Das Gegenteil ist richtig. Wir liegen bei der Steuerquote deutlich unterhalb des EU- und des OECD-Durchschnitts.
Die OECD-Zahlen messen die Steuerbelastung der gesamten Volkswirtschaft. Bei der Belastung von Unternehmenserträgen liegen wir nach anderen Erhebungen international und europäisch eher im Mittelfeld.
Nein - wir sind nicht in der Mitte, wir sind unten. Es gibt Volkswirtschaften, in denen insgesamt noch weniger Steuern gezahlt werden - Griechenland zum Beispiel hat eine Steuerquote von 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wir liegen bei etwas mehr als 23 Prozent, der Durchschnitt der OECD- und EU-Staaten liegt bei rund 27 Prozent. Gemessen am BIP käme ein Betrag von 80 bis 100 Milliarden Euro zusammen, wenn wir bei der Steuerquote nur zum Durchschnitt aufschließen würden.
Sie haben selbst darauf hingewiesen, dass die gefühlte Steuerlast wohl eher an der Spitze angesiedelt wird. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Die Wahrnehmung steht im deutlichen Kontrast zu den tatsächlichen Verhältnissen. Allerdings sind wir bei der steuerlichen Belastung der Lohneinkommen im oberen Mittelfeld. Arbeitnehmer im Bereich mittlerer Einkommen sehen sich spürbar und prominent besteuert. Nur darf man deshalb nicht von sich darauf schließen, dass diese hohe Besteuerung für alle gilt.
Für die breite Mittelschicht spielt bei einer Substanzsteuer wie der Vermögenssteuer die Frage der Freibeträge eine große Rolle. Wie weit in die Mitte der Gesellschaft soll so eine Vermögenssteuer hineinreichen?
Wir reden bei der Vermögens- und Erbschaftssteuer nicht über Omas kleines Häuschen, sondern über die Villa mit Park und Seezugang. Wir wollen die Vermögenssteuer erst bei Vermögen oberhalb von 500.000 Euro einsetzen lassen - und dann ein Prozent der Vermögenseinkünfte besteuern. Bei vielleicht drei oder vier Prozent Rendite kann man in diesem Zusammenhang von Substanzbesteuerung sicher nicht reden.
Kritiker sprechen von einer unzulässigen Doppelbesteuerung. Schließlich wurde bereits die Einkommenssteuer kassiert.
Dann erleiden all die Vermögenden in den Industriestaaten ja wirklich ein verdammt hartes Schicksal. Ein Schicksal, das ihnen aber gleichwohl zugemutet werden kann - und ihnen auch hierzulande zugemutet werden sollte.
Immer mehr Bürger sind wütend darüber, dass Banken mit Unsummen vor der Pleite bewahrt wurden, die Arbeitnehmer nun aber die Zeche zahlen sollen.
Die Wut in den Betrieben hält sich noch deutlich in Grenzen. Dabei bleibt das sogenannte Sparpaket der Bundesregierung eine völlige Leerstelle, wenn es darum geht, auch Vermögende und Kapitalbesitzer heranzuziehen. Gleichzeitig wird die Rechnung für die Krise insbesondere den Schwächsten in der Gesellschaft präsentiert. Das geschieht in einer Art und Weise, die bis hinein in traditionelle Wählermilieus auch der Unionsparteien nicht mehr vermittelbar ist. Diese Regierung stellt den Zusammenhalt der Koalition über den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Viele Gewerkschaften in europäischen Nachbarländern drohen inzwischen offen mit politischen Streiks. Wie steht ver.di zu dieser Option?
Wir wollen politischen Druck aufbauen. Das gehört zu den Aufgaben, die wir uns für den Herbst vorgenommen haben. Wir wollen und müssen dabei mehrgleisig operieren. Politische Streiks sind für uns kein Tabu - das ist kein Geheimnis.
ZUR PERSON
FRANK BSIRSKE, geboren 1952 in Helmstedt als Sohn eines VW-Arbeiters und einer Krankenschwester, steht seit ihrer Gründung im Jahr 2001 an der Spitze der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), die rund 2,1 Millionen Mitglieder vertritt. Er gilt als begabter Taktiker. Wo es nötig ist, kann er sich lautstark Gehör verschaffen, weswegen politische Gegner ihm gelegentlich Populismus vorwerfen. Doch wer ihn kennt, schätzt ihn als jemanden, der zuhören und auf Leute zugehen kann. Bsirske war Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung und arbeitete zehn Jahre lang als Bildungssekretär der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken. Von 1997 bis 2000 war er als Grünen-Stadtrat sowie als Personal- und Organisationsdezernent für die Landeshauptstadt Hannover tätig. Zuvor arbeitete er in wechselnden Funktionen für die ÖTV, deren Vorsitzender er 2000 wurde. Bsirske ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und Aufsichtsratsmitglied bei der RWE und der Lufthansa. In der Freizeit erholt er sich von seinem Polit-Job durch Lesen, Kino und Jazzmusik.