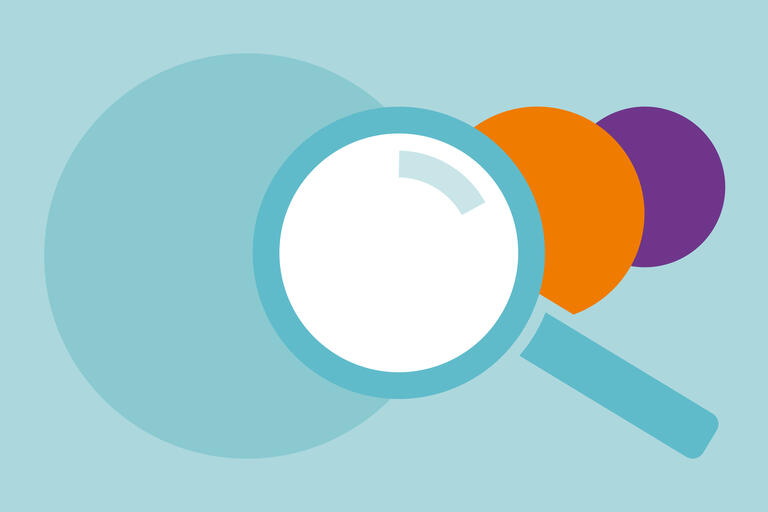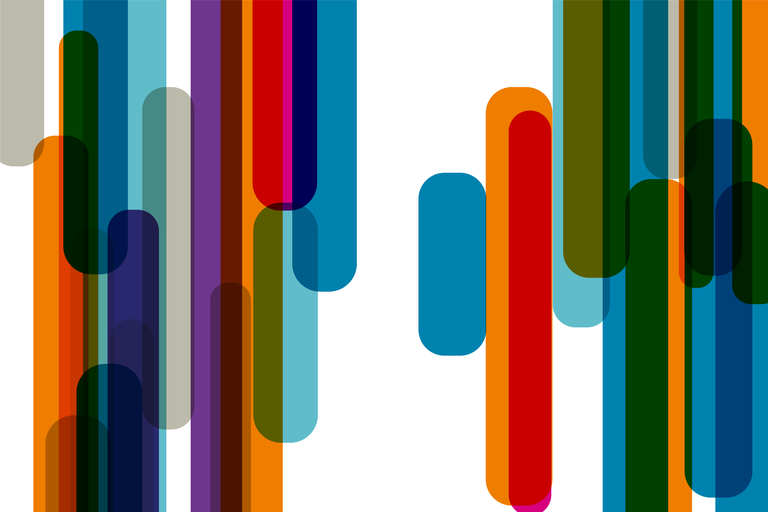Kliniken: Jeder kämpft für sich allein
Immer mehr Pflegekräfte wechseln für deutlich mehr Gehalt aus Krankenhäusern zu Verleihfirmen. Vielerorts verschärft das die Probleme auf den Stationen dramatisch. Von Andreas Molitor
Besser als bei Nora Hinz* kann ein Jobwechsel in der Krankenpflege eigentlich nicht laufen. Die 30-Jährige arbeitet 25 Stunden pro Woche, genau wie auf ihrer alten Stelle in einem Hamburger Krankenhaus, wo sie bis vor einem Jahr beschäftigt war, aber auf ihrer Gehaltsabrechnung steht jetzt ein ganz anderes Nettosalär: 3000 statt früher 1700 Euro. Ihr drei Jahre jüngerer Bruder Jochen*, der ein halbes Jahr früher die Stelle gewechselt hat, verdient jetzt 3200 Euro netto für 30 Stunden Arbeit. Vorher waren es 2300 Euro für 39,5 Stunden. Allerdings haben die beiden nicht einfach einen ganz normalen Jobwechsel vollzogen, von einer Klinik in die andere, sondern beim Krankenhaus gekündigt und bei einer jener Personalleasingfirmen angeheuert, die Pflegekräfte gezielt von Krankenhäusern abwerben und dann wiederum an Kliniken verleihen.
Als Leasingkraft trage ich leider mit dazu bei, dass das System immer kränker wird.“
Immer mehr solcher Unternehmen wetteifern um wechselwillige Pflegekräfte, jagen sich mit Kopfprämien von mehreren Tausend Euro die Arbeitskräfte ab, die genug haben von mageren Löhnen, schlechten Arbeitsbedingungen und starren, familienunfreundlichen Schichtsystemen.
Die Kliniken wiederum, dringend auf Leihpersonal angewiesen, zahlen in ihrer Not fast jeden Preis: bis zu 85 Euro plus Spesenpauschale, alles in allem also über 100 Euro pro Stunde. „Wirtschaftlich ist das Gift, die Leasingkosten versauen in vielen Häusern das Jahresergebnis“, kritisiert Matthias Gruß von der Verdi-Fachkommission Altenpflege. Er kennt auch die Situation in den Kliniken gut. Vor allem nachts und am Wochenende sind vielerorts Schichten ausschließlich mit Leihkräften besetzt, erzählt Jochen Hinz: „Auf manchen Stationen siehst du von Freitagabend bis Montagmorgen niemanden aus der Stammbelegschaft mehr.“
Auf den Stationen, wo Stamm- und Leasingkräfte Seite an Seite arbeiten, sprechen sich die Gehaltsunterschiede schnell herum. Das wiederum beschleunigt die Abwanderung in die Leiharbeit. Erster Schritt ist oft ein Zusatzjob beim Verleiher, ein paar Stunden pro Woche. Früher oder später wechseln die meisten dann ganz ins Leasing. In Deutschland stieg die Zahl der Leihkräfte in der Krankenpflege seit 2017 von 17 693 auf 25 582. In Berlin liegt ihr Anteil schon bei zehn Prozent, Tendenz steigend. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft trifft es genauso wie private Kliniken, wo der Gewinn der Aktionäre ohnehin meist Vorrang vor guten Arbeitsbedingungen hat.
Die Gewerkschaft Verdi sieht das naturgemäß mit Argwohn, allein schon weil die Leasingfirmen in der Regel mitbestimmungsfreie Zonen sind. Außerdem verschärft der Sog, der von den Verleihern ausgeht, die ohnehin dramatischen Personalengpässe in den Krankenhäusern. Doch ein simples Verbot lehnt die Gewerkschaft ab. Im Bereich der Pflege stehen die Dinge auf dem Kopf“, sagte Matthias Gruß vom Verdi-Fachbereich Altenpflege. Er argumentiert, dass Arbeitgeber durch verbindliche Dienstpläne und tarifvertragliche Bezahlung erreichen müssten, „Pflegepersonen zu halten und neue zu gewinnen“. Individuell sei mehr als verständlich, dass Pflegekräfte über die Leiharbeit bessere Bedingungen für sich herausholen wollten, heißt es bei der Gewerkschaft. „Für die Versorgung der Patienten und Pflegebedürftigen und für die Zusammenarbeit im Team ist es aber verheerend.“ Betriebsräte an der Basis sehen das ähnlich. Bernd Gräf, Beschäftigtenvertreter am Universitätsklinikum Mannheim, das jährlich zwischen fünf und zehn Millionen Euro für Leasingkräfte ausgeben muss, findet es „gut, dass Pflegekräfte sich nicht mehr alles bieten lassen und für sich nach Verbesserungen suchen. Aber den Häusern bricht es das Genick.“
Rote Linie vom Personalrat
An der Düsseldorfer Uniklinik hat der Personalrat dafür gesorgt, dass rote Linien für den Einsatz von Leasingkräften eingezogen wurden. Eine Vereinbarung mit der Klinikleitung bestimmt, dass Leihbeschäftigte genauso zum Dienst eingeteilt werden wie alle anderen und ihre Wünsche nicht mehr automatisch Vorrang haben. Außerdem dürfen die Leasingkräfte nicht länger als neun Monate am Stück am Uniklinikum tätig sein, und in einer Schicht darf nie mehr als eine Leihkraft arbeiten.
Weit radikaler ist der Vorschlag von Carla Eysel, Personalchefin der Berliner Charité. Sie möchte den Grundsatz umkehren, dass Verleiher nicht schlechter bezahlen dürfen als die Träger, in deren Kliniken ihre Leute eingesetzt werden. „Nicht nur schlechtere, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen verletzen den Gleichheitsgrundsatz“, argumentiert sie. Alle sollen also gleich schlecht bezahlen. Fragt sich nur, ob dies dazu führt, dass Leasingkräfte scharenweise wieder in die Krankenhäuser zurückströmen – oder ob sie sich nicht gleich einen anderen Beruf suchen.
Die Leasingfirmen locken nicht nur mit mehr Geld, sondern vor allem mit Flexibilität und individuell planbaren Arbeitszeiten. Die Beschäftigten können ihre Einsatzschichten wahlweise gehaltsmaximierend mit möglichst vielen Einsätzen in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen oder aber familienfreundlich planen. „Im Krankenhaus konnte ich den regelmäßigen Wochenenddiensten nicht entgehen, da wurde wenig Rücksicht genommen“, erzählt Nora Hinz. „Immer wieder musste ich einspringen, wenn Kolleginnen erkrankt waren, egal ob bei mir zu Hause die Kinder mit Fieber im Bett lagen. Oder es wurde einfach kurzfristig der Urlaub gestrichen.“ Sie hat zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre alt, und ist alleinerziehend. „Jetzt kann ich mir die Tage und die Schichten, in denen ich arbeiten will, frei auswählen. Ich kann die 14 Tage fast am Stück arbeiten oder auf den ganzen Monat verteilen.“
„Nach so einer Schicht bist du völlig durch“
Für die Beschäftigten ist die Flucht ins Leasing oft die einzige Möglichkeit, im Job zu bleiben, ohne sich völlig zu verschleißen. Nora Hinz hatte letztens 14 Patienten in der Frühschicht, sie war ganz alleine auf der Station. „Nach so einer Schicht bist du völlig durch“, sagt sie. „Da bin ich so froh, dass ich Leasingkraft bin.“ Für annähernd das gleiche Gehalt müsste sie als Stammkraft im Dreischichtbetrieb Vollzeit arbeiten, „das würde ich als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern nicht durchhalten“.
Mit diesem Pfund wuchern die Leasingfirmen. Negovan Mladenovic, Geschäftsführer des in Berlin beheimateten Personaldienstleisters Just New Line, betont, dass in seiner Firma „sehr viele alleinerziehende Mütter arbeiten – und zwar nicht primär wegen des Geldes, sondern weil die Krankenhäuser es einfach nicht schaffen, diese Frauen so in den Schichtbetrieb zu integrieren, dass sie ihre Arbeitszeiten mit der Kinderbetreuung vereinbaren können“. Im Gegenzug erwarten die Leasingfirmen von ihren Beschäftigten jede Menge Flexibilität. Wo sie eingesetzt werden, bestimmt der Arbeitgeber beziehungsweise die Nachfrage der Kliniken, die Personal anfordern. Sie können jeden Tag in ein anderes Krankenhaus geschickt werden. Gute Pflegekräfte werden allerdings immer wieder von den gleichen Stationen gebucht. Nora und Jochen Hinz etwa arbeiten schon seit Monaten auf der gleichen Station in der gleichen Klinik, fast wie Stammkräfte.
Für die Stammbelegschaften dagegen sind die als Entlastung gedachten Leasingkräfte häufig eine zusätzliche Belastung. Die verbliebenen Beschäftigten, tendenziell eher die Älteren, müssen ihre Dienste häufig um die Einsätze der Leihkräfteherum planen, was den Dienstplänen den letzten Rest von Flexibilität nimmt. Ständig müssen sie neue Kräfte einweisen. Im Uniklinikum Mannheim etwa gibt es eine Checkliste, was man den Leihkräften alles zeigen und erklären muss. Doch was nützt die, wenn die Leute am nächsten Tag wieder woanders sind und neue Kräfte dastehen und nicht wissen, was zu tun ist? Jochen Hinz berichtet, dass kürzlich auf einer Station an einem Wochenende keine Medikamente bestellt wurden, weil die Leasingkräfte nicht wussten, wie das geht. Am Montag waren dann etliche Arzneimittel nicht verfügbar. „Oder sie reagieren völlig hysterisch, wenn ihnen in der Psychiatrie beim Öffnen der Zimmertür eine vollgemachte Windel entgegengeflogen kommt.“
Wir würden unsere Leasingkräfte niemals als Streikbrecher einsetzen.“
Kein Wunder, dass es auf vielen Stationen um den Ruf der Leihkräfte nicht zum Besten bestellt ist. „Du wirst in der Stammbelegschaft kaum jemanden finden, der nicht sagt, wie ätzend er uns Leasingleute findet“, sagt Jochen Hinz. Die
Leasing-Arbeitgeber wiederum sehen sich als unverzichtbare Ergänzung, keinesfalls als Spalter. „Niemals würden wir unsere Mitarbeiter beispielsweise als Streikbrecher einsetzen“, versichert Negovan Mladenovic, der Geschäftsführer von Just New Line. „Das habe ich auch den Verdi-Leuten gesagt, als die Gewerkschaft kürzlich an der Charité zum Streik aufgerufen hat.“
Am Sonntag krank? Pech gehabt
Die Nachteile des Leasings werden beim Blick auf die erste Gehaltsabrechnung oft ausgeblendet: weniger Urlaub, nur ein schmales oder gar kein Weihnachtsgeld, keine vermögenswirksamen Leistungen, und bei Krankheit an Sonn- und Feiertagen zahlen die meisten Leasingfirmen keinen Lohn. Fortbildungen müssen die Leiharbeiter in der Regel in ihrer Freizeit absolvieren.
Jochen Hinz fühlt sich wohl in der Leasingfirma, der Umgang mit den Chefs sei fast freundschaftlich, sagt er. Trotzdem würde er jederzeit wieder zurück ins Krankenhaus gehen – wenn die Bedingungen stimmen. „Wenn ich Herr meines
eigenen Dienstplans wäre und mir meine Arbeitszeiten selbst aussuchen könnte, würde ich 500 Euro Gehaltseinbuße in Kauf nehmen.“
Seine Schwester Nora sieht es ähnlich: „Für mich persönlich ist Leasing eine gute Lösung“, bilanziert sie. Aber die Qualität der Pflege leide. „In dem System möchte man kein Patient sein. Und ich trage leider mit dazu bei, dass das System immer kränker wird.“ Teamarbeit sei immer wichtig für sie gewesen, sagt sie. „Mich mit anderen um die Patienten kümmern, das war mal der Grund, warum ich Krankenschwester geworden bin“. Heute gehe es letztlich nur noch ums Geld. Kurze Pause. Dann sagt sie: „Es ist so traurig, dass ich mittlerweile so denke.“