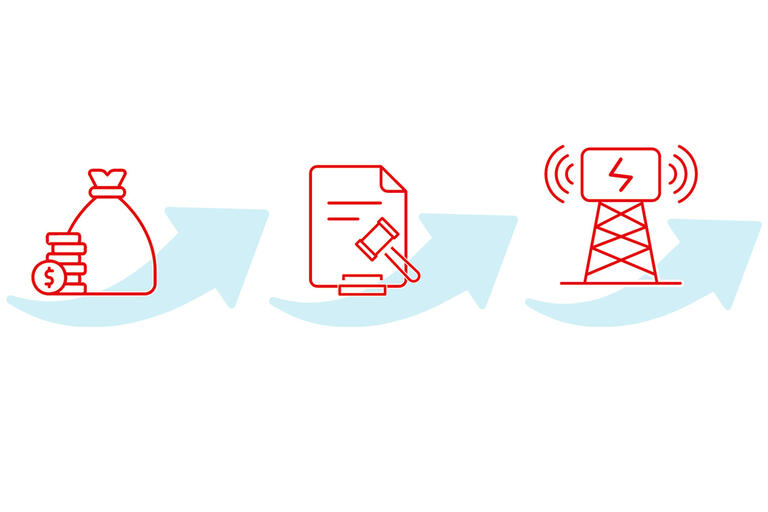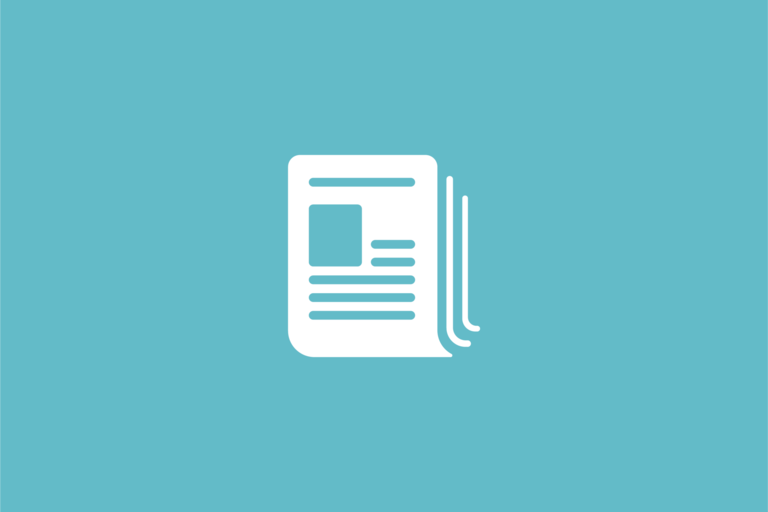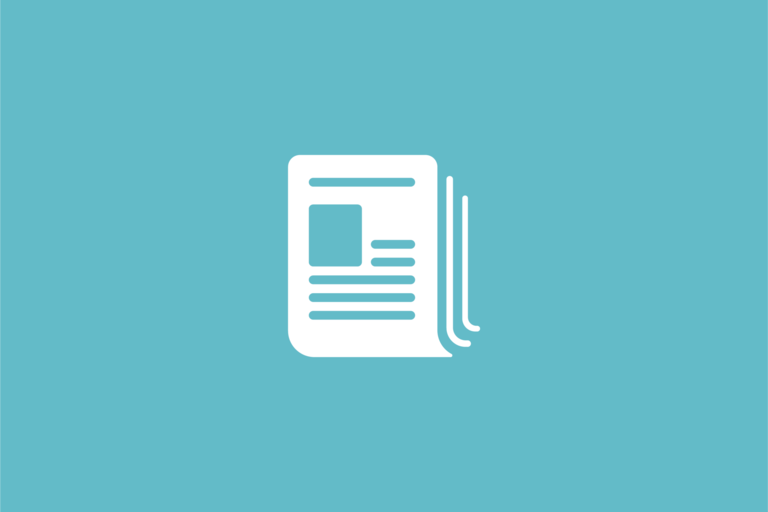: Die lange Agenda der Regulierer
EUROPA Wie kann der Finanzsektor stärker auf eine dienende Rolle gegenüber der Realwirtschaft verpflichtet werden? Wie kann der zerstörerische Einfluss dieses Sektors auf Unternehmen eingedämmt werden? Ein Blick auf wichtige EU-Projekte. Von Lothar Kamp
LOTHAR KAMP ist Leiter der Abteilung Mitbestimmungsförderung und einer der Finanzmarktexperten der Hans-Böckler-Stiftung/Foto: Mario Vedder, ddp
Finanzmärkte, und so war es auch dieses Mal, geraten insbesondere dann aus den Fugen, wenn Politiker eine große Liberalisierungswelle ausgelöst haben. Derartige Aktionen werden damit begründet, dass so ein größeres Wirtschaftswachstum entstehe. Auch die deutschen Regierungen unter den Kanzlern Kohl und Schröder trieben entsprechende Liberalisierungen voran. Die rot-grüne Bundesregierung erklärte offensiv, dass eine starke Wirtschaft auch einen starken Finanzstandort bräuchte. In der Folge wurden viele Beschränkungen für Finanzmarktakteure aufgehoben oder abgemildert. Wenn dann die Schäden, die man so befördert hat, groß genug sind, beginnt eine neue Regulierungswelle. Möglicherweise stecken wir in einer solchen Phase.
VERBRIEFUNGEN WERDEN ERSCHWERT_ Ein vorrangiges Regulierungsziel sind stabile, verantwortliche, der Realwirtschaft dienende Banken. Regulierung der Banken beginnt damit, dass möglichst erst keine Risiken ins Bankensystem gelangen, vor allem im Kreditgeschäft. Ein sehr großes Segment von Krediten betrifft den Hypothekensektor. Er war auch Auslöser der gegenwärtigen Finanzkrise. Es gab Zeiten, da war die Vergabe von Hypothekenkrediten praktisch überall auf der Welt solide. Kreditnehmer für ein Haus oder eine Wohnung hatten Eigenkapital mitzubringen, sodass sie im Risiko standen; sie mussten ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse präzise offenlegen, sodass abschätzbar war, ob sie in Zukunft die Kredite zurückzahlen konnten; die Kreditzinsen waren fest; Monat für Monat musste eine verkraftbare Tilgungsrate abgeleistet werden. Diese solide Praxis wurde in vielen Ländern aufgegeben, nicht nur in den USA, sondern auch in Irland, Großbritannien und Spanien. Daraus entstandene Risiken befanden sich nun im Bankensystem. Die Banken in den USA und einigen anderen Ländern wollten nicht darauf sitzen bleiben und mit Eigenkapital absichern müssen. Sie wandelten („verbrieften“) die Kredite in handelbare Wertpapiere um und verkauften sie weltweit. Die schlechtesten unter diesen Papieren, in denen Kredite von Leuten steckten, die sich eigentlich kein Haus leisten konnten und die die Schulden niemals zurückzahlen würden, bewerteten Ratingagenturen mit der Bestnote AAA. Tatsächlich handelte es sich um Schrott. Diese „toxischen“ Papiere konzentrierten sich bald stark in wenigen großen Finanzinstituten, weil damit hohe Renditen zu erzielen waren, aber auch in westdeutschen Landesbanken und der IKB-Bank.
Die Lehre daraus: Sowohl in den USA als auch in der EU wird Verbriefung erschwert. Verbriefende Banken können nicht mehr ihre kompletten Risiken aus den Bilanzen entfernen, sondern müssen immer fünf Prozent des Kreditrisikos behalten. So wird die Verantwortung für die Verbriefung gestärkt. Ratingagenturen werden in der EU schärfer überwacht, es gibt ein besonderes Zulassungsverfahren und zum ersten Mal die Möglichkeit, gegen die Agenturen zu klagen, wenn sie grob ihre Pflichten verletzen. Unternehmen werden stärker verpflichtet, selbst ihre Risiken zu bewerten; das externe Rating durch Agenturen soll zurückgedrängt werden. Jedoch geben EU-Kommission und die europäischen Regulierungsbehörden Risikobewertungsmodelle vor, die auch viele Banker nicht verstehen und die den Instituten ein Stück Eigenverantwortung wieder abnehmen.
DAS REGULIERUNGSPAKET BASEL III_ Die weltweite Regulierung von Banken wird sehr stark geprägt durch den „Basel-Ausschuss“. Dies ist ein Gremium aus Bankaufsehern, angesiedelt bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und beauftragt von den G20-Regierungschefs. Ende 2010 legte der Ausschuss das neue Regulierungspaket „Basel III“ vor. In der EU wird dieses Paket derzeit unter dem Namen „CRD IV“ (Capital Requirements Directive – Kapitaladäquanz-Richtlinie) umgesetzt. Danach müssen Banken bedeutend mehr Eigenkapital als Risikoabdeckung hinterlegen als in der Vergangenheit. Das unmittelbar haftende, sofort verfügbare Eigenkapital („hartes Kernkapital“) wird von heute zwei Prozent bis 2019 auf sieben Prozent erhöht, darunter ein „Kapitalerhaltungspuffer“, für den in schwierigen Zeiten Auszahlungssperren bei Dividenden oder Boni angeordnet werden können. Das qualitativ schlechtere „Ergänzungskapital“ sinkt von vier auf zwei Prozent. Weiterhin soll ein antizyklischer Puffer von bis zu 2,5 Prozent angelegt werden, der in guten Zeiten aufgebaut wird und in schlechten Zeiten genutzt werden kann. Und schließlich sollen systemisch weltweit wichtige Finanzinstitute weiteres Kapital bis zu 3,5 Prozent bilden. In Deutschland zählen dazu die Deutsche Bank und die Commerzbank.
Bei diesen großen Banken würde das gesamte risikobezogene Eigenkapital von bisher acht auf bis zu 16,5 Prozent steigen. Das Eigenkapital soll verhindern, dass Banken aufgrund von Verlusten aus Risiken insolvent gehen können und wie in der Finanzkrise das gesamte Finanzsystem gefährden. Gegenüber früheren Zeiten erscheint dies viel, aber Kritiker wenden ein, dass Banken ein ähnlich hohes Eigenkapital wie normale Unternehmen vorhalten sollten, also rund 30 Prozent, damit sie auch große Krisen durchstehen können.
Zusätzlich zur risikobezogenen Eigenkapitalbestimmung wird eine von den Banken einzuhaltende Kennziffer („Leverage Ratio“) eingeführt, die unabhängig von den Risiken einer Bank ihre Gesamtverschuldung misst. Damit soll der in der Vergangenheit viel zu hohe Verschuldungsgrad („Leverage“) reduziert werden, der in guten Zeiten die Gewinne erhöht, in schlechten aber zu enormen Risiken führt. Vorgesehen ist ein Faktor von 33, das heißt, Banken können 33-mal so viel Geld weitergeben, wie sie an Eigenkapital besitzen. Kritiker betonen, dass dieser Wert viel zu hoch ist. Der Finance-Watch-Experte Thierry Philipponnat hält die Risikogewichtung zur Stabilisierung der Banken nicht für geeignet, sondern nur die Leverage Ratio. Die neue Regulierung verlangt von den Banken außerdem, dass sie ihre Liquidität kurz- und mittelfristig kontrollieren, also für laufende Zahlungen „flüssig“ bleiben. Dies war bei vielen Banken in der Finanzkrise nicht mehr der Fall.
GEFÄHRLICHE ANREIZE IM VISIER_ Die Finanzkrise brachte auch die alte Frage, Trenn- oder Mischbanken-System, wieder in die Diskussion. Ein Gesetz trennte in den USA von 1933 bis 1999 Geschäfts- und Investmentbanken voneinander. Einlagen von Sparern, die außerdem gesetzlich abgesichert waren, sollten nicht für riskante Geschäfte des Investment-Bankings genutzt werden dürfen; Kredite an Realwirtschaftsunternehmen sollten nicht gefährdet werden. Nachdem in den USA dieses Gesetz 1999 unter Clinton abgeschafft wurde, soll es nun – mit einer Reihe von Ausnahmen – wieder in Kraft treten. In Großbritannien müssen die beiden Geschäftszweige bis 2019 in den Banken strikt getrennt werden. Die britische Kommission, die die Regulierung entwarf, konnte sich nicht mit der Idee durchsetzen, diese Geschäfte in völlig eigene Institute auszugliedern. In der EU und in Deutschland haben zu diesem Thema bisher lediglich Diskussionen begonnen.
An der Krisenentstehung beteiligt waren auch falsche Anreizstrukturen in Form von Boni, die Banker zu riskanten kurzfristigen Geschäften verführten. Sowohl in den USA als auch in der EU arbeiten die Regulierer daran, dass die Vergütungsstrukturen nicht mehr wie bisher kurzfristige, auf Maximalrenditen zielende Anreize setzen, sondern den langfristigen und nachhaltigen Erfolg der Institute garantieren. Und damit einzelne strauchelnde Banken nicht mehr das gesamte Finanzsystem gefährden können, haben Regulierer auf der ganzen Welt gesetzliche Verfahren entwickelt, die es Aufsichtsbehörden erlauben, eine Bank geordnet abzuwickeln. Ein EU-Gesetzesvorschlag orientiert sich stark am deutschen Bankenrestrukturierungsgesetz.
LICHT IN DIE GRAUZONE_ Im Gegensatz zum Bankensektor ist der sogenannte Schattenbankensektor bisher nicht reguliert. Zu ihm zählen Hedgefonds, Private-Equity-Fonds, Repo-Fonds und Geldmarkt-Fonds. Der Sektor ist höchst intransparent und wegen seiner Größe, die in etwa dem des Bankensystems entspricht, sowohl für den Finanzsektor wie für die Realwirtschaft extrem gefährlich. Repo-Fonds geben den Banken für eine sehr kurze Frist Geld gegen Wertpapiere, bald danach wird das Geschäft wieder rückabgewickelt. Geldmarkt-Fonds nehmen den Banken – ebenfalls gegen Geld und ebenfalls sehr kurzfristig – Schuldverschreibungen ab. Vor der Krise haben viele Banken dieses kurzfristige Geld für langfristige risikoreiche Geschäfte genutzt. Geld mit kurzer Frist wurde in Geld mit langer Frist verwandelt, „Fristentransformation“ genannt. Aus diesen Geschäften erwuchsen immense Risiken. Die IKB finanzierte so beispielsweise langfristige Papiere aus dem toxischen Hypothekenbereich und nutzte dazu eine eigene Gesellschaft, die wiederum zum Schattenbankenbereich gehörte. Als sowohl die toxischen Papiere im Wert abstürzten als auch die kurzfristigen Geldgeber der Fonds aus Misstrauen kein Geld mehr bereitstellten, brach dieses Kartenhaus zusammen. Der Staat musste mit einem riesigen Geldbetrag einspringen.
„Die Krise hat uns unerbittlich vor Augen geführt, wie komplex und undurchsichtig bestimmte Aktivitäten und Produkte geworden sind. Das muss sich ändern“, erklärte Binnenmarktkommissar Barnier Mitte Oktober bei der Vorstellung neuer EU-Vorschriften für transparentere Finanzmärkte in Europa. Technisch gesehen handelt es sich dabei um eine Überarbeitung der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid (Markets in Financial Instruments Directive). Sie regelt seit November 2007 die Bedingungen für den Wertpapierhandel europaweit.
Mit der jetzt geplanten Novelle verfolgt die Kommission das Ziel, das Geschehen im Schattenbankensektor in den regulierten Bereich herüberzuziehen. Auch will sie Spekulationspraktiken in den Griff bekommen, die an den Finanzmärkten für große Unruhe sorgen. So soll der Hochfrequenzhandel kontrolliert werden. In diesem werden, nur von Computern, Wertpapiere im Millisekundentakt gehandelt. Zudem plant die Kommission mehr Transparenz und Kontrolle an den Derivatemärkten.
Derivate sind von bestimmten anderen Werten abgeleitete Verträge. Dabei wird auf die Preisentwicklung dieses Wertes gewettet – seien es Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen oder Rohstoffe. Die gefährlichsten Derivate werden nicht an der Börse, sondern „over the counter“ (OTC), also am Telefon oder über elektronische Handelssysteme vereinbart. Sehr oft sind Derivate reine Spekulationsgeschäfte. Das Risiko liegt in der Insolvenz eines Wettpartners. Wenn er groß genug ist, kann dies Turbulenzen an den Märkten bewirken. Das gegenwärtige Volumen aller Derivatkontrakte beträgt weltweit über 600 Billionen Dollar, also grob das Zehnfache der weltwirtschaftlichen Gesamtleistung.
Um Wetten – auf den Preisverfall von bestimmten Vermögenswerten, zum Beispiel von Aktien – handelt es sich auch bei den sogenannten Leerverkäufen. Sie gehören zum Geschäftsfeld vieler Hedgefonds und anderer Institutionen des Schattenbankenbereiches. Es gibt gedeckte Leerverkäufe, bei denen der Spekulant zum Zeitpunkt der Wette den Vermögenswert besitzt, und es gibt ungedeckte, wo dies nicht der Fall ist. Letztere ermöglichen eine Wette in unbeschränkter Höhe. In den USA sind Verbote von Leerverkäufen nur bei einem sehr starken Kursverfall des zugrunde liegenden Vermögenswertes vorgesehen, ansonsten unbeschränkt erlaubt. In der EU soll nach dem Willen von Kommission und Parlament eine Fülle von Auflagen ungedeckte Leerverkäufe ab November 2012 faktisch unmöglich machen.
IMMERHIN EIN ANFANG_ Angesichts der verheerenden Auswirkungen der aktuellen Finanzkrise sind die begonnenen Regulierungsmaßnahmen, obwohl sehr zahlreich, in vielen Punkten zu schwach, zu zögerlich, zu langfristig angelegt oder treffen möglicherweise nicht den richtigen Punkt, wie beim risikogewichteten Eigenkapital von Banken. Pragmatisch kommt es im Augenblick jedoch darauf an, das Begonnene unter Abwehr der zahlreichen Finanzlobbyisten durchzusetzen. Eine schlagkräftige Aufsicht muss die laufende Anwendung des Regulierungswerkes überwachen. Das ist schwer genug. Denn eine erfolgreiche Umsetzung setzt voraus, dass die Aufsichtsbehörden über ausreichend und gut qualifiziertes Personal verfügen. Doch dem Finanzsektor gelingt es immer wieder, die qualifiziertesten Leute abzuwerben. Und Aufseher wie Politik werden mit dem Argument unter Druck gesetzt, dass Regulierung wirtschaftliche Schäden verursache.
Finanzmärkte
REGULIERER UND AUFSEHER
Die Regulierung von Finanzmärkten erfolgt in Deutschland durch den Bundestag und – bei Runderlassen – auch durch Ministerien. Die Aufsicht über Banken nehmen die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wahr. Bei Ausführungsbestimmungen können auch sie Vorschriften erlassen. Wie in Deutschland gibt es in jedem EU-Staat nationale Regulierungs- und Aufsichtsinstanzen.
Auf EU-Ebene sind die gesetzgebenden Instanzen das Europaparlament, der Rat (Regierungsvertreter der EU-Staaten) und die EU-Kommission. Eine neue Struktur der Finanzaufsicht wurde mit dem Europäischen Finanzaufsichtssystem (ESFS) zum 1. Januar 2011 geschaffen. Dazu gehört der neu geschaffene Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), dessen Hauptaugenmerk nicht auf der Überwachung einzelner Finanzinstitute liegt, sondern der die Risiken des gesamten Systems im Blick haben soll. Dazu gehören auch die drei Aufsichtsbehören für Banken (EBA), für Börsen- und Wertpapiere (ESMA) sowie für Versicherungen und Pensionsfonds (EIOPA).
Die EU-Gesetzgebung erfolgt erstens in Form von Richtlinien, die die EU-Staaten in nationales Recht umsetzen müssen und in begrenztem Umfang ausgestalten können. Zweitens in Form von Verordnungen, die unmittelbar für alle EU-Staaten gelten und für einheitliches Recht in Europa sorgen.