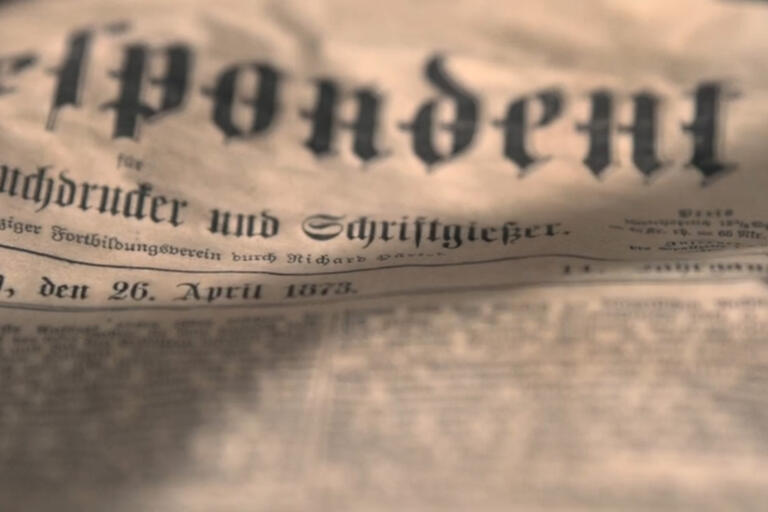Politik: Dass alles einmal besser wird
Kein sozialer Fortschritt ohne soziale Bewegungen: Indem die Gewerkschaften für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, treiben sie gesellschaftliche Innovationen voran, deren Wurzeln weit zurückgehen. Von Fabienne Melzer und Kay Meiners
Achtstundentag
Im Jahr 1903 streiken im sächsischen Crimmitschau Textilarbeiterinnen 22 Wochen lang für den Zehnstundentag. Sie fordern: „Eine Stunde mehr für uns. Eine Stunde fürs Leben.“ Der Streik geht verloren, doch der Kampf geht weiter. Arbeiten die Menschen zu Beginn der Industrialisierung 14 bis 17 Stunden täglich, sinkt die Arbeitszeit 1912 auf 57 Stunden pro Woche. Dabei postuliert schon in den 1810er Jahren Robert Owen, der walisische Unternehmer und Sozialreformer, den Achtstundentag: „Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden Freizeit.“ Das ist eine der ältesten Forderungen der Arbeiterbewegung.
In Deutschland bringt erst das Ende des Ersten Weltkriegs den so lange geforderten Achtstundentag. Angesichts der Unruhen im November 1918 geben die Kapitalvertreter ihren Widerstand gegen Tarifverträge auf. Geheimrat Hilger, Vorsitzender des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrie, erklärt: „Nur durch Verhandlungen speziell mit den Gewerkschaften können wir Anarchie, Bolschewismus, Spartakusherrschaft und Chaos verhindern.“ Am 15. November schließen Gewerkschaften und Arbeitgeber das Stinnes-Legien-Abkommen, in dem die regelmäßige Arbeitszeit in allen Betrieben auf acht Stunden täglich ohne Lohnabzug festgelegt wird.
Sozialversicherung
Im Mittelalter ist die Fürsorge für Kranke und Bedürftige Sache der Kirche. Wem die Caritas, die christliche Tugend der Nächstenliebe, zuteil wird, hängt von vielen Umständen oder vom Zufall ab. Die meisten Menschen sterben jung. Im Dreißigjährigen Krieg werden viele Fürsorgeeinrichtungen zerstört. Ein anderes System erweist sich gegenüber der bloßen Mildtätigkeit als überlegen. Jahrhunderte, bevor der Staat sich Gedanken über die soziale Sicherung macht, haben Bergleute- und Handwerkergilden Kassen nach dem Solidaritätsprinzip eingerichtet, um Mitgliedern in Not zu helfen. Sie sind die Pioniere der Sozialversicherung. Mit dem Beginn des Industriezeitalters verlieren sie an Bedeutung, aber die neu entstehenden Arbeitervereine und Gewerkschaften tragen den Funken der solidarischen Selbsthilfe weiter. Erst im 19. Jahrhundert interveniert der Staat. Die Sozialversicherung, die das Deutsche Reich ab 1883 einführt, macht Deutschland zum weltweiten Vorreiter bei der Einführung von Sozialsystemen. Ein Motiv ist, den Zulauf zur Sozialdemokratie und zur Arbeiterbewegung zu Gunsten eines paternalistischen Staates zu stoppen. Reichskanzler Otto von Bismarck formuliert es so: „Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen, oder soll ich sagen, zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte.“ Heute bestimmen die Gewerkschaften über die Sozialpolitik und über die Selbstverwaltung die Leistungen der Sozialversicherung mit.
Frauenwahlrecht
Mit der Industrialisierung brechen alte Familienstrukturen auf. Frauen müssen in den Fabriken arbeiten, weil der Lohn eines Arbeiters keine Familie ernährt. Sie treten den Arbeiterbewegungen bei und fordern ökonomische und politische Rechte. Dabei kämpfen sie nicht nur gegen bestehende Strukturen, sondern manchmal auch gegen Gewerkschafter und ihre eigenen Ehemänner. Frauen werden schlechter bezahlt und gelten manchen als Lohndrückerinnen. Eine englische Frauenrechtlerin beschreibt es als einen Kampf mit einer Hand auf dem Rücken: „Öffentliche Missbilligung kann man aushalten, aber der Ärger zu Hause war eine sehr bittere Sache.“
Aber es gibt auch Unterstützung: Arbeiter streiken für das Frauenwahlrecht, und die Sozialdemokraten haben es seit 1891 in ihrem Erfurter Programm. Im November 1918 erhalten Frauen in Deutschland das aktive und das passive Wahlrecht. In einigen anderen westeuropäischen Ländern dauert es länger. In Großbritannien etwa bis 1928, in Frankreich bis 1945, und die Schweizerinnen müssen bis 1971 warten, ehe sie das Wahlrecht erhalten.
Fünftagewoche
Unter dem Motto „Samstags gehört Vati mir“ starten alle DGB-Gewerkschaften Mitte der 1950er Jahre ihren Kampf um kürzere Arbeitszeiten. Es geht um mehr Zeit für die Familie, um mehr Freizeit und um mehr Gesundheit. Das Arbeitstempo in der Industrie hatte sich in den Jahren des Wiederaufbaus enorm erhöht. Die Zahl der Krankentage und Arbeitsunfälle war sehr hoch. Mit dem Bremer Abkommen gelingt der IG Metall 1956 der Durchbruch. In allen Tarifbezirken sinkt die tarifliche Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 48 auf 45 Stunden pro Woche. 1960 vereinbart die IG Metall im Abkommen von Bad Homburg die stufenweise Absenkung der Arbeitszeit auf 40 Stunden pro Woche. Doch kurz vor dem Ziel stellen sich die Arbeitgeber quer. 1963 streiken die Metaller für die 40-Stunden-Woche. Die Arbeitgeber antworten mit Aussperrungen. Nach erneuten Verhandlungen wird die 40-Stunden-Woche in der Metallindustrie am 1. Januar 1967 eingeführt. Andere Branchen ziehen nach. Doch erst Ende der 1970er Jahre gehört Vati fast überall samstags der Familie.
Homeoffice
Seit der Pandemie ist das alte Normal – fünf Tage in der Woche in den Betrieb gehen – für viele nicht mehr normal. Im neuen Normal entscheiden die Beschäftigten selbst, wo sie arbeiten. Anfang der 1980er Jahre gab es in Deutschland die ersten Arbeitsplätze außerhalb des Betriebs, die damals unter dem sperrigen Namen „Telearbeitsplatz“ liefen. Allerdings waren sie so selten, dass es in einer Studie hieß: Die Suche nach ihnen sei die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und obwohl die Technik in großen Schritten voranging, änderte sich daran wenig. Zu sehr war die Präsenzkultur vor allem in den Köpfen vieler Vorgesetzter fest verankert. Erst der Coronavirus katapultierte mobile Arbeit in die Gegenwart. Arbeiteten vor der Pandemie lediglich vier Prozent der Beschäftigten außerhalb des Betriebs, lag ihr Anteil während des Lockdowns teilweise bei 27 Prozent.
Viele Beschäftigte machten die Erfahrung, dass die Arbeit von zu Hause durchaus Vorteile hat. Zeiten für Arbeitswege fielen weg, niemand riss einen plötzlich aus der Arbeit heraus, und Termine mit Handwerkern ließen sich nebenbei erledigen. Auch die Arbeitgeber lernten dazu und legten ihr Misstrauen ab. Denn der Betrieb lief weiter.
Doch es gab auch Nachteile. Viele hatten das Gefühl, zu Hause länger zu arbeiten und Privates und Arbeit nicht mehr klar trennen zu können, wie Analysen des WSI zeigten. Auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen fehlte. Die Pandemie hat den Trend zwar beschleunigt und ein neues Normal geschaffen, das sich nicht mehr vollkommen zurückdrehen lässt. Aber über die Bedingungen wird in vielen Unternehmen derzeit verhandelt. Denn gute Arbeitsbedingungen sind immer eine Frage guter betrieblicher Regelungen – egal ob im Betrieb, unterwegs oder zu Hause.
Vereinbarkeit
Die Industrialisierung zerstört das, was seit Jahrtausenden normal war: die Einheit von Arbeits- und Wohnstätte. Auch wenn der Lebensstandard in den westlichen Ländern im 20. Jahrhundert ein Niveau erreicht hat, das frühen Ökonomen wie Karl Marx unvorstellbar erschien, bleibt der Grundkonflikt zwischen Arbeit und Privat bestehen. Durch Arbeitsverdichtung, Stress und gestiegene Ansprüche an die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen gewinnt er wieder an Brisanz. Seit den 1980er Jahren taucht in der Frauenbewegung in Großbritannien und in den USA der Begriff „Work-Life-Balance“ auf. Während die US-Soziologin Arlie Russell Hochschild in ihrem Buch „The Time Bind“ 1997 feststellt, dass in den USA familienfreundliche Arbeitsorganisation kaum angenommen werde, schreibt Elisabeth von Thadden 2001 in der Zeit, in Europa vollziehe sich „eine beachtliche Gegenbewegung zur kompletten Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt“. Heute bekommen Unternehmen, die keine Konzepte für Vereinbarkeit vorlegen, nur noch schwer qualifiziertes Personal. Neue Gesetze sollen die Work-Life-Balance verbessern und längere Familienzeiten ermöglichen, wie das Elternzeitgesetz von 2007 und das weniger gut angenommene Pflegezeitgesetz von 2008.
Lohnfortzahlung
Dass der Arbeitgeber im Krankheitsfall den Lohn weiterzahlen soll, ist auch im 20. Jahrhundert vielen Chefs nicht einsichtig. Sie verweisen auf das bescheidene Krankengeld. Gewerkschaften sehen das anders. Doch erst in den Jahren 1956 und 1957 erkämpft die IG Metall in einem Streik diese Errungenschaft. Sie erlebt sofort eine Bewährungsprobe, als die Asiatische Grippe umgeht, die allein in Westdeutschland Zehntausende Menschen tötet. Allerdings dauert es noch bis 1969, ehe die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten erreicht ist. So lange stockt für Arbeiter ein Zuschuss der Arbeitgeber das Krankengeld auf 90 Prozent des Nettoentgelts auf. Noch einmal wird das Erreichte angegriffen: 1996 kürzt CDU-Kanzler Helmut Kohl die Fortzahlung auf 80 Prozent. Gewerkschafter erzürnt, dass manche Arbeitgeber die gesetzliche Kürzung zum Anlass nehmen wollen, auch die in Tarifverträgen vereinbarte volle Lohnfortzahlung auszuhebeln. Als der Vorstand der Daimler-Benz AG beschließt, die neue Regel anzuwenden, legen 30 000 Konzernbeschäftigte die Arbeit nieder. Im gesamten Bundesgebiet kommt es in der Metallindustrie zu Arbeitsniederlegungen. In Tarifverhandlungen können die Gewerkschaften für rund neun Millionen Beschäftigte die volle Lohnfortzahlung sichern, das neue Gesetz können sie nicht beseitigen. Erst 1998 macht die erste rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder es rückgängig.