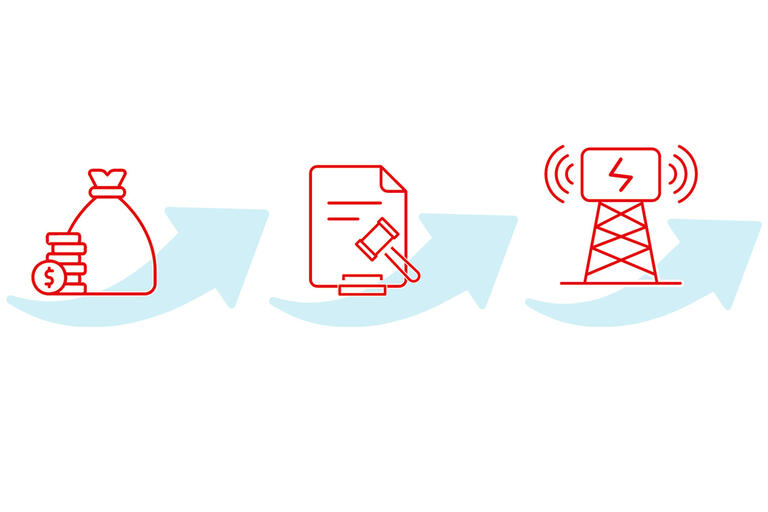Makroökonomie: Koordinierte Politik für Europas Löhne
Die Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie wichtig international abgestimmte makroökonomische Politik ist. Vorhandene Ansätze zu einer dauerhaft besseren Kooperation in der EU könnten ausgebaut werden.
Weltweit aufgelegte Konjunkturprogramme und Zinssenkungen haben den Absturz der Wirtschaft gestoppt - ein eindrucksvoller Beleg für die Wirkung internationaler makroökonomischer Koordinierung, so Willi Koll und Volker Hallwirth vom Bundeswirtschaftsministerium. Dieses Politikfeld lag jedoch in Europa lange Zeit brach. Der Mangel an gesamtwirtschaftlicher Zusammenarbeit war ihrer Analyse zufolge ein wesentlicher Grund für das Entstehen krisenverschärfender wirtschaftlicher Ungleichgewichte in Europa.
Dabei existiert in der EU seit 1999 eine Institution, die helfen soll, Finanz- und Lohnpolitik in den Mitgliedstaaten sowie die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) besser aufeinander abzustimmen: Der Makroökonomische Dialog (MED). Zweimal jährlich treffen sich Vertreter des Europäischen Rates, der EU-Kommission, der EZB und der nationalen Zentralbanken mit Vertretern der Sozialpartner. Das etwa 20 Personen umfassende Gremium fällt keine formalen Beschlüsse, die Mitglieder geben die Ergebnisse der Sitzungen aber an ihre jeweilige Institution weiter.
Ministerialdirigent Koll und Regierungsdirektor Hallwirth haben die Makro-Politik der EU und die Rolle des MED in den vergangenen zehn Jahren untersucht. Sie plädieren dafür, den Makroökonomischen Dialog zu verbessern und diesem bisher oft stiefmütterlich behandelten Gremium größeres politisches Gewicht zu verleihen.
Wo die Makro-Koordination der EU in der Vergangenheit versagt hat, zeigt der Rückblick der beiden Wirtschafsexperten auf die letzten zehn Jahre. Zwar wurde das geldpolitische Ziel, die durchschnittliche Preissteigerung im Euroraum auf knapp zwei Prozent zu begrenzen, meist eingehalten. Doch entwickelten sich andere gesamtwirtschaftliche Größen nicht zufriedenstellend. Die Arbeitslosenquote stieg nach dem Platzen der New-Economy-Blase an und blieb lange hoch; die "angestrebte deutliche Rückführung" der Staatsschulden gelang nicht. Vor allem lief die Wirtschaftsentwicklung einiger Länder stark auseinander - wodurch mit den Jahren große Ungleichgewichte entstanden. Dies wird besonders deutlich beim Vergleich von Deutschland und Spanien.
In Vorbereitung auf die Währungsunion hatte Spanien seine Leitzinsen gesenkt, um sie dem Niveau der übrigen Euro-Teilnehmer anzupassen. Dieser Impuls kurbelte das Wirtschaftswachstum an, ließ Beschäftigung und Löhne steigen. Höhere Steuereinnahmen ermöglichten der spanischen Regierung höhere Staatsausgaben ohne die Maastricht-Kriterien zu verletzen. Infolge überwälzter Erhöhungen bei den Produktionskosten stiegen auch die Preise - stärker als von der EZB gewünscht. Die Zentralbank konnte dagegen allerdings nichts tun, weil sie ihre Politik an den Durchschnittswerten des gesamten Euroraums ausrichten musste und auf einzelne Ausreißer-Länder keine Rücksicht nehmen konnte. Auch die spanischen Immobilienpreise stiegen erheblich, was wiederum die Bauwirtschaft stimulierte. Die Kehrseite des Booms: Überdurchschnittliche Lohnsteigerungen verringerten die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, so dass Spanien bald viel mehr importierte, als es selbst mit Exporten einnehmen konnte. Das Leistungsbilanzdefizit betrug im Jahr 2007 schließlich zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wegen der schwachen Wettbewerbssituation verlangen Kapitalgeber inzwischen "empfindliche" Risikoaufschläge, wenn sie Spanien Geld leihen.
Die spanische Wirtschaft konnte sich aber nur so entwickeln, weil in anderen Ländern, vor allem in Deutschland, das Gegenteil geschah: Geringe Lohnzuwächse steigerten die Wettbewerbsfähigkeit und bremsten den Preisauftrieb. Entsprechend nahmen die Exportüberschüsse immer weiter zu. Diese Ungleichgewichte nahmen der EZB die Möglichkeit, ihre Zinspolitik so zu gestalten, dass sie für alle Länder des Euroraums angemessen war. Die Zinspolitik war für Spanien zu expansiv, für Deutschland jedoch zu restriktiv.
"Die langfristigen Effekte dieser Divergenzen wurden wirtschaftspolitisch lange Zeit missachtet", schreiben Koll und Hallwirth. Zeitweilig wurde das Auseinanderdriften der Löhne durch Wachstum im gesamten Euroraum verdeckt; die Spaltung weiter zu ignorieren, erweise sich aber "in Zeiten der Krise mit aller Härte als nicht mehr fortsetzbar".
Der MED als Koordinationsplattform bedürfe daher einer inhaltlichen und institutionellen Stärkung. Die Lohnentwicklung in den Euroländern solle sich idealerweise "stabilitätsorientiert, verteilungs- und wettbewerbsneutral am länderspezifischen Produktivitätswachstum sowie am Preisziel der EZB" orientieren. Frühere Verletzungen dieser Regel müssten korrigiert werden. Organisatorisch sei es vor allem an den Sozialpartnern, Strukturen aufzubauen, die eine bessere Abstimmung auf nationaler wie europäischer Ebene ermöglichten. Aber auch politisch sollte der MED, dem kurz nach seiner Einrichtung "der paradigmatische Rückenwind" ausgegangen sei, nach Ansicht der Autoren aufgewertet werden. Denn die lange vorherrschende Ansicht, es komme nur auf Strukturreformen an, nicht jedoch auf "makroökonomische Gestaltung", sei durch die aktuelle Krise widerlegt.
Willi Koll, Volker Hallwirth: Macro Matters: Der Makroökonomische Dialog der Europäischen Union, in: WSI-Mitteilungen 09/2009