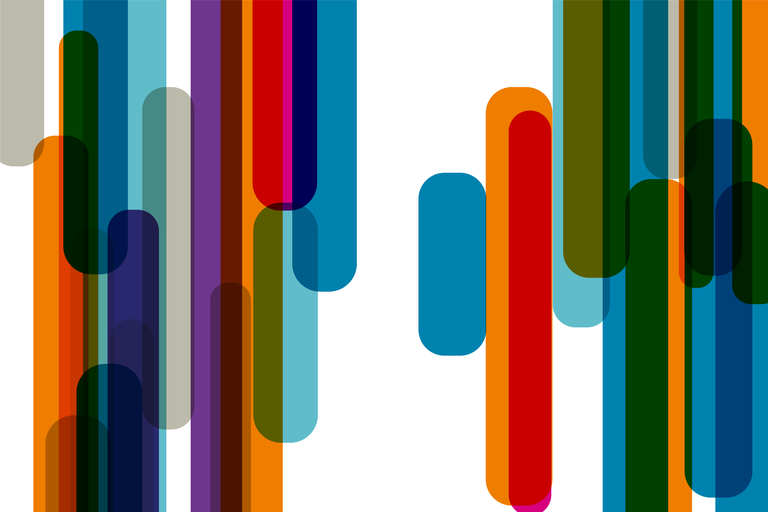Wirtschaftskrise: Job gerettet, Unbehagen bleibt
Die jüngste Wirtschaftskrise hat in deutschen Unternehmen kaum zu sozialen Konflikten geführt. Zwar ist der Unmut vieler Beschäftigter groß – er richtet sich aber meist nicht gegen den eigenen Betrieb.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 bis Anfang 2010 hat Arbeitnehmer in Deutschland in der Regel nicht den Arbeitsplatz gekostet. Dennoch haben viele die Folgen des jüngsten Konjunktureinbruchs unmittelbar zu spüren bekommen. Die Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation – oft als „permanente Krise“ erlebt – ist vielfach groß, hat ein Forscherteam um den Soziologieprofessor Dieter Sauer vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in München beobachtet. Der Betrieb gelte den Belegschaften jedoch zumeist nicht „als relevanter Ort der Krisenbearbeitung“. Der Verdruss richtet sich weniger gegen die eigene Geschäftsführung, sondern eher gegen Politik und Finanzmarktakteure. Im Grundsatz werde die Wirtschaftskrise jedoch systemisch gedeutet. Die formulierte Kritik sei damit immer auch Systemkritik, so Sauer. Bei den Beschäftigten dominierten das Gefühl der Ohnmacht und Ratlosigkeit.
Die Analyse der Wissenschaftler beruht auf Interviews und Gruppendiskussionen mit Vertrauensleuten und Betriebsräten aus der Metall- und Elektroindustrie. Sauer und seine Forscherkollegen haben die Aussagen im Frühsommer 2010 aufgezeichnet. Zwar haben die Befragten den vorausgegangenen Produktionseinbruch recht unterschiedlich erlebt. Dennoch lassen sich den Sozialforschern zufolge drei typische Muster der Krisenwahrnehmung herausarbeiten:
Krise als Schock: Ein Teil der Beschäftigten nahm die Krise als „herben Schlag“ wahr – sowohl für den Betrieb als auch für die persönliche berufliche Karriere. Die plötzliche Verschlechterung der ökonomischen Situation habe Zukunftspläne zunichte gemacht. Dadurch sei man wieder „ganz unten“. Gleichzeitig sehen Beschäftigte, die sich in diesem Sinne äußern, die Wirtschaftskrise oft als zeitlich begrenztes Phänomen an; wie eine Grippe, von der man sich wieder erholt.
Krise als permanenter Prozess: Häufiger anzutreffen ist die Ansicht, die jüngste Konjunkturkrise sei kein außergewöhnliches Ereignis, sondern reihe sich in eine lange Folge ähnlicher Erfahrungen ein. Durch „ständige Standort- und Arbeitsplatzbedrohungen“ sei bei vielen Arbeitnehmern eine gewisse „Krisenroutine“ entstanden. „An dieses ständige Infragestellen des Arbeitsplatzes gewöhnt man sich eigentlich auch“, wie es einer der Interviewten ausdrückt.
Krise als machtpolitische Inszenierung: Andere betrachten die Krise als Inszenierung, die nur der Bereicherung bestimmter Gruppen diene. Einerseits verweisen diese Befragten auf die Banken, die eigentlich die einzigen seien, die in der Krise steckten. Andererseits kritisieren sie die Unternehmen der Realwirtschaft, die „die angebliche Krise“ als Vorwand genutzt hätten, ihre Profite zu erhöhen.
Insgesamt habe nur eine Minderheit die Krise als biografischen Einschnitt erlebt, berichten die Forscher. Für die Mehrheit sei sie eher eine „Bestätigung langjähriger Erfahrungen“ gewesen. Unsicherheit und Brüche in der Erwerbsbiografie seien für viele nichts Neues, sie seien im Umgang mit prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen bereits geschult. Wer die Krise als „harten Schlag“ bezeichnete, hätte dagegen zuvor oft unter relativ sicheren Bedingungen gearbeitet.
Deutlich spürbar war die Krise für viele Arbeitnehmer, wie die Interviews ergaben. So vertieften der rasche Abbau der Leiharbeit und die Beendigung befristeter Beschäftigungsverhältnisse die Kluft zwischen Stamm- und Randbelegschaft. Die mit Zeitkonten und Kurzarbeit erreichte „Ultra-Flexibilisierung“ der Arbeitszeit rettete zwar Jobs. Sie verschärfte aber noch einmal den Druck auf die Beschäftigen, Freizeit- und Familienbedürfnisse den ökonomischen Anforderungen des Betriebs zu unterwerfen. Schließlich forderte die Krise Arbeitnehmern durch vorübergehende oder dauerhafte Umstrukturierungen mehr Flexibilität ab – etwa Beschäftigten der Autoindustrie, die von einem fachlich hochwertigem Arbeitsplatz in der Oberklasse-Produktion ans Fließband in der dank Abwrackprämie boomenden Kleinwagenfertigung versetzt wurden.
All dies mache den Beschäftigten zu schaffen und sie kritisierten einzelne Maßnahmen in ihrem Betrieb, so die Forscher. Im Grundsatz würden Belegschaften und Interessenvertretungen die Krisenbewältigungsstrategien des Managements jedoch mittragen – allerdings ohne ihre kritische Distanz aufzugeben. Was auf Betriebsebene geschehe, erscheine meist alternativlos und unausweichlich. Die Beschäftigten fühlen sich ohnmächtig, schreiben die Wissenschaftler. Es sei zwar ein „erhebliches Wut- und Protestpotenzial spürbar“, doch es fehle der richtige Adressat für den Ärger der Arbeitnehmer. Die nebulösen Krisenursachen verstärkten die Unsicherheit und die mangelnde Orientierung. Oft richte sich der Unmut in diffuser Weise gegen „Staat und Politik“. Die Politik erscheine nicht als möglicher Problemlöser, sondern vielmehr selbst als Teil des Problems.
Richard Detje, Wolfgang Menz, Sarah Nies, Dieter Sauer: Krise ohne Konflikt? Zur Wahrnehmung der Wirtschaftskrise aus Sicht der Betroffenen, in: WSI-Mitteilungen 10/2011