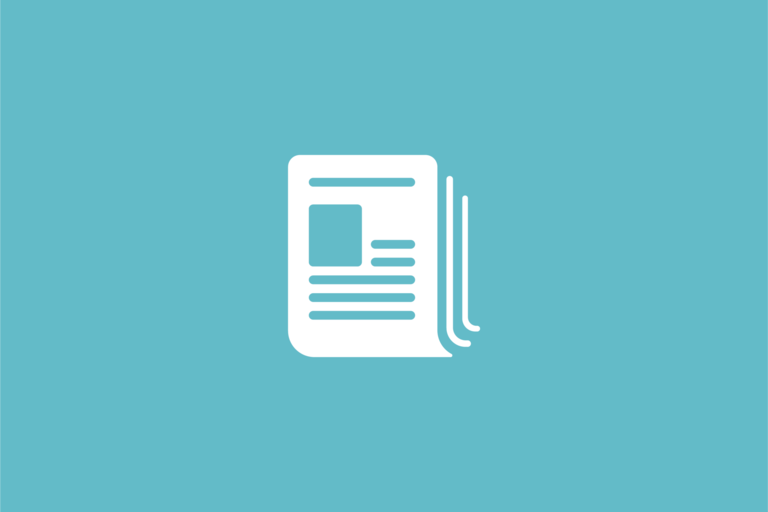Wirtschaftswissenschaft: Geschlossene Gesellschaft
Ohne staatliche Hilfe wäre die Weltwirtschaft in der jüngsten Krise komplett zusammengebrochen. Trotzdem hängt der ökonomische Mainstream weiter am Dogma des unfehlbaren Markts. Denn die jahrzehntealten Netzwerke der Marktfundamentalisten sind stabil.
Wieso hat sich nach der Krise so wenig in der Wirtschaftswissenschaft verändert? Diese Frage beantworten Walter Otto Ötsch, Stephan Pühringer und Kathrin Hirte. Die Wissenschaftler von der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues beziehungsweise der Universität Linz haben sich die Inhaber von Ökonomie-Lehrstühlen genauer angeschaut. Ihr Datensatz umfasst gut 780 Professoren – und wenige Professorinnen –, die zwischen 1954 und 1994 in der Bundesrepublik einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre innehatten. Die Suche nach Gemeinsamkeiten und Verbindungslinien förderte ein bis in die unmittelbare Nachkriegszeit zurückreichendes „Netzwerk von Marktfundamentalisten“ zutage. Dabei handelte es sich häufig um besonders „einflussreiche“ Professoren. Sie haben viel publiziert, waren als politische Berater tätig und in den Medien präsent – und hinterließen damit, so die Begrifflichkeit der von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie, einen tiefen „performativen Fußabdruck“. Ein Kernergebnis der Untersuchung: Von den 28 Ökonomen, die sich „als besonders wirkmächtig herausgestellt haben, sind 15 beziehungsweise 54 Prozent über Netzwerke des deutschen Marktfundamentalismus miteinander verbunden“.
Dass die hauptsächlich untersuchte Gruppe keine Professoren beinhaltet, die nach 1994 berufen worden sind, hat vor allem methodische Gründe, erklären die Forscher. Hätten sie wesentlich jüngere Professoren aufgenommen, wäre deren „performativer Fußabdruck“ nicht sinnvoll mit dem älterer Kollegen zu vergleichen gewesen, die mehr Zeit hatten, ihren Einfluss auszubauen. Dennoch zeigten Analysen mit Daten aus den Jahren 2015 und 2016, dass die Dominanz der Marktgläubigen unverändert besteht, so die Autoren.
Marktfundamentalisten lehnen Regulierung ab
Unter Marktfundamentalismus verstehen Ötsch, Pühringer und Hirte eine Geisteshaltung, die „den Markt“ nicht allein als Mechanismus zum Austausch von Gütern und Geld ansieht, sondern ihn zum „Subjekt“ macht. „Der Markt“ wird als eine Naturgewalt verstanden, die alle Probleme löst – sofern der Staat sich nicht einmischt. Entsprechend halten Marktfundamentalisten Regulierungen stets für problematisch. Auch wenn sie in Detailfragen unterschiedliche ökonomische Ansätze verfolgen: In diesem Punkt sind sich alle einig.
Den Grundstein für diese Vorstellungswelt haben die sogenannten Ordoliberalen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit Ökonomen aus den USA und Großbritannien gelegt, mit denen sie sich in der Mont Pèlerin Society, einer Art marktradikalen Internationalen, zusammenschlossen. Angeführt vom Freiburger Wirtschaftsprofessor Walter Eucken setzten sich die deutschen Vertreter für die Einführung der Marktwirtschaft in der Bundesrepublik ein – zu einer Zeit, als etwa in der CDU das Programm eines „christlichen Sozialismus“ viel populärer war. Letztlich waren die Ordoliberalen aber erfolgreich, mit Ludwig Erhard wurde ein Marktwirtschaftler Wirtschaftsminister.
Marktfundamentalisten sind sehr gut vernetzt
Bis heute wirken die Grundüberzeugungen der Ordoliberalen in der deutschen Ökonomie nach, so die Forscher. Sie würden in der akademischen Welt immer wieder reproduziert. Beispielsweise promovierte Eucken selbst nicht weniger als elf Ökonomen, die wiederum einen Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften bekamen. Und diese hatten ebenfalls Schüler, die Professoren wurden, Schlüsselpositionen in Ministerien besetzten oder Wirtschaftsinstitute leiteten. Über Lobby-Einrichtungen und Thinktanks wie den Kronberger Kreis oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sei das marktfundamentale „Denkkollektiv“ eng verbunden, schreiben die Autoren. Dass die Marktfundamentalisten sehr gut vernetzt seien, habe sich beispielhaft vor der Bundestagswahl 2005 gezeigt, als fast 250 Wirtschaftsprofessoren den sogenannten Hamburger Appell unterschrieben – ein Plädoyer für mehr Niedriglohnbeschäftigung, Deregulierung sowie die Kürzung öffentlicher Ausgaben und Sozialleistungen.
Offenbar hat die Mehrheit der hochrangigen, öffentlich und politisch einflussreichen Ökonomen in Deutschland den Glauben an den unfehlbaren Markt so tief verinnerlicht, dass ihr zur zwei Jahre später ausbrechenden globalen Krise wenig einfiel, mutmaßen Ötsch, Pühringer und Hirte. Und so kommt es wohl auch, dass sich im Wirtschaftsstudium bis heute kaum etwas geändert hat.
Wissenschaftler sind objektiv. Sie stellen Hypothesen auf und überprüfen sie mit Experimenten oder indem sie das Weltgeschehen genau beobachten. Hat sich eine Theorie als falsch erwiesen, wird sie durch eine neue ersetzt. Neue Schulen lösen alte ab, wenn die früheren Weisheiten nicht mehr haltbar sind. Für persönliche Vorlieben, politische Überzeugungen, Herdenverhalten, Karrieredenken oder Gruppendruck ist in der Sphäre der Forschung kein Platz. Diese idealisierte Vorstellung von Wissenschaft haben viele im Kopf.
Tatsächlich funktioniert die akademische Welt aber nicht so, betonen Ötsch, Pühringer und Hirte. Nicht nur Fakten spielen eine Rolle, sondern soziale Faktoren ebenso. Es bilden sich „Denkkollektive“ heraus, die über lange Zeiträume bestehen können, auch wenn sie theoretische Rückschläge erleiden – wenn sich etwa die Annahme, Finanzmärkte regulieren sich selbst, sofern der Staat nicht eingreift, als vollkommen falsch erweist.
Abgesehen von der grundsätzlichen Schwierigkeit, in den Gesellschaftswissenschaften allgemeingültige Beweise zu führen: Wissenschaftler brauchen nicht nur gute Ideen, sondern sie müssen auch Kontakte pflegen, um voranzukommen. „In der Geschichte der deutschsprachigen Ökonomik nach 1945 haben sich nicht die ,besseren’ Theorien durchgesetzt, sondern jene, die in jeweils wirkmächtigster Resonanz zu anderen Bereichen der Gesellschaft standen“, schreiben Ötsch und seine Kollegen. Dem „Ordoliberalismus als deutsche Variante des Neoliberalismus“ sei es gelungen, mithilfe seines „beständigen Einflusses auf die Politik“, ein dauerhaftes „Institutionen- und Beziehungsnetzwerk zu schaffen, welches sich nachhaltig und konsistent reproduzieren konnte“. Das habe auch Zeiten überstanden, in denen der Marktglaube eigentlich aus der Mode gekommen war, wie die kurze keynesianische Phase der bundesrepublikanischen Wirtschaftspolitik in den späten 1960er-Jahren.
Der üblichen Wissenschafts-Geschichtsschreibung, der Dogmengeschichte, blieben solche Zusammenhänge weitgehend verborgen, erklären die Autoren. Denn Dogmenhistoriker schauen meist nur auf einer recht formalen Ebene, wie sich bestimmte Theoreme verändert haben oder ob neue dazugekommen sind. Der einende „Kollektivgedanke“ und „Denkstil“ – etwa Markt gut, Staat schlecht – einer Wissenschaftlergruppe werde jedoch kaum beachtet. Ebenso wenig kommen Personennetzwerke vor, etwa die elitäre internationale Mont Pèlerin Society, in der Wissenschaftler zusammenkommen, die zwar an ganz unterschiedlichen theoretischen Wirtschaftsmodellen arbeiten, aber eine gemeinsame politische Agenda verfolgen.
Walter Otto Ötsch, Stephan Pühringer, Kathrin Hirte: Netzwerke des Marktes, Wiesbaden 2017