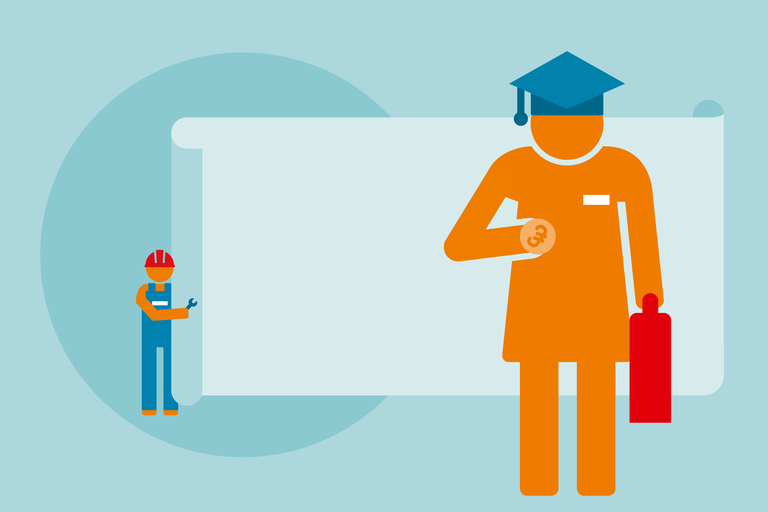Hochschulen: Forschung: Der falsche Wettbewerb
Universitäten werden heute wie Unternehmen geführt - mit Blick auf einen guten Platz im Hochschulranking. Aus der Wirtschaft entliehene Verfahren zur Bewertung von Forschungsleistungen sind jedoch nur bedingt geeignet, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzubringen.
Regelmäßige Evaluationen sollen die Effizienz erhöhen - ob in Krankenhäusern, Arbeitsagenturen oder an Hochschulen. Doch zum wissenschaftlichen Wettbewerb um die beste Theorie passt der betriebswirtschaftliche Controlling-Ansatz nicht. Im Gegenteil: Er verstärkt den Druck auf Wissenschaftler, sich der herrschenden Lehrmeinung anpassen, statt mit neuen Ideen zu experimentieren. Denn die Kreativität von Außenseitern wird von den üblichen Bewertungsmodellen nicht belohnt, schreiben die Soziologen Richard Münch und Max Pechmann, die die Folgen der "Evaluitis" an Universitäten untersucht haben. Sie kritisieren zudem, dass die öffentlichkeitswirksamen Wettbewerbe um die besten Evaluations-Noten den Konzentrationsprozess in der Bildungslandschaft fördern: Unis oder Fachbereiche mit der besten finanziellen Ausstattung ziehen die bekanntesten Forscher an. Denen falle es am leichtesten, ihre Forschungsergebnisse erfolgreich zu vermarkten und Pluspunkte bei der nächsten Evaluation zu sammeln - was wiederum zu höheren Zuwendungen für die jeweilige Forschungseinrichtung führe.
Die Angst, übersehen zu werden. Bis vor wenigen Jahren war der intellektuelle Wettbewerb mit Fachkollegen eine Sache der Forscher selbst, nicht die der Universitäten. Das hat sich Münch und Pechmann zufolge geändert: Die "internationale Sichtbarkeit" von Hochschulen sei zu einem der meistgebrauchten Begriffe der Forschungspolitik geworden. Es sollen akademische Leuchttürme entstehen, die mit Harvard, Yale und Oxford mithalten können. In diesem Modell kämpften nicht mehr in erster Linie Wissenschaftler um Erkenntnisfortschritte, sondern Hochschulen um Marktanteile, konstatieren die Autoren. Dass dabei eine Zwei-Klassen-Forschung entstehe, müsse nach Meinung der Protagonisten der Exzellenz-Strategie hingenommen werden. Evaluationen und anschließende Rankings seien das Hauptinstrument, um die vermeintlich besten Unis herauszufiltern.
Woran ist gute Forschung zu erkennen? Ein Erklärungsfaktor für den Erfolg der wachsenden "Evaluationsindustrie" besteht der Studie zufolge darin, dass sie Ergebnisse in Form von Zahlen liefert: leicht zu verstehen und scheinbar objektiv. Allerdings haben die Soziologen Zweifel, ob die von Evaluatoren genutzten Methoden - vor allem Veröffentlichungen und Zitate in internationalen Fachzeitschriften zählen - ein angemessener Indikator für die Qualität von Wissenschaft sind. Solche Ergebnisse seien durch strukturelle Faktoren verzerrt: Professoren mit vielen Mitarbeitern können mehr produzieren als andere. Wer ein deutschsprachiges Lehrbuch statt eines englischen Zeitschriftenaufsatzes schreibt, geht leer aus. Wer dem wissenschaftlichen Mainstream folgt, hat bessere Chancen, gedruckt und zitiert zu werden als Querdenker. Die Auswahlverfahren der Fachzeitschriften wirkten wie eine "Gedankenpolizei", so die Studie.
Rankings sind anfällig für Manipulationen. Neue Regeln im akademischen Betrieb führen zu neuen Verhaltensweisen. So zerhacken einige Forscher ihre Ergebnisse absichtlich in kleine Portionen, um die Zahl ihrer Veröffentlichungen zu steigern, oder versuchen auf andere Weise Ranking-relevante Größen zu manipulieren. Münch und Pechmann nennen ein besonders absurdes Beispiel aus den USA: Hier laden Law Schools auch unqualifizierte Schüler zur Bewerbung ein, um im Hochschulranking mit einer hohen Ablehnungsquote zu glänzen - mit der Behauptung sie hätten ein besonders hartes Auswahlverfahren und würden nur die besten aufnehmen. Andere Hochschulen oder einzelne Institute stellen kurz vor dem Evaluationstermin vorübergehend möglichst viele publikationsstarke Wissenschaftler ein. Fachbereiche, die weniger Ranking-Erfolg versprechen, werden an den Rand gedrängt. "Das Ranking-Spiel prämiert am Ende diejenigen Fachbereiche, die über genügend Kapital verfügen, um systematisch die Kennziffern zu ihren Gunsten zu beeinflussen", urteilen die Autoren.
Konzentration auf wenige Unis. Der Kampf der Hochschulen um Marktanteile, "die Logik des akademischen Kapitalismus", führe zu einer Konzentration der prominentesten Wissenschaftler und in der Folge der meisten Forschungsgelder an wenigen Standorten, heißt es in der Studie. Der so genannte Matthäus-Effekt: Wer hat, dem wird gegeben. Dies nützt dem wissenschaftlichen Fortschritt nach Münch und Pechmann aber nicht unbedingt. Größenvorteile durch eine standardisierte Massenproduktion gebe es zwar in der Industrie. In der Wissenschaft gehe es jedoch "um eine größtmögliche Zahl singulärer Produkte, die sich im Wettbewerb um Erkenntnisfortschritt durchsetzen müssen".
Die Autoren weisen außerdem auf gesellschaftliche Konsequenzen einer in wenige Elite- und viele Massenuniversitäten gespaltenen Hochschullandschaft hin. In Japan und Südkorea zeige sich, dass eine durch ständige Rankings zweigeteilte Uni-Landschaft letztlich auch auf Schule und Arbeitsmarkt wirke: Wer nicht schon von der Elite-Schule kommt, hat kaum eine Chance von der Elite aufgenommen zu werden und anschließend einen Top-Job zu bekommen. In letzter Konsequenz verbaue eine solche Hochschulpolitik soziale Aufstiegschancen, resümieren die Wissenschaftler.
Richard Münch, Max Pechmann: Der Kampf um Sichtbarkeit. Zur Kolonisierung des wissenschaftsinternen Wettbewerbs durch wissenschaftsexterne Evaluationsverfahren, in: Jörg Bogumil, Rolf G. Heinze (Hrsg.): Neue Steuerung von Hochschulen - eine Zwischenbilanz, edition sigma, Berlin 2009