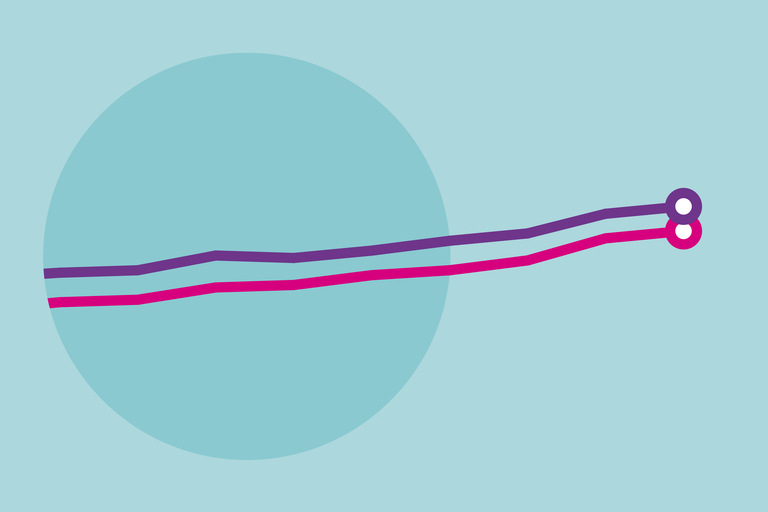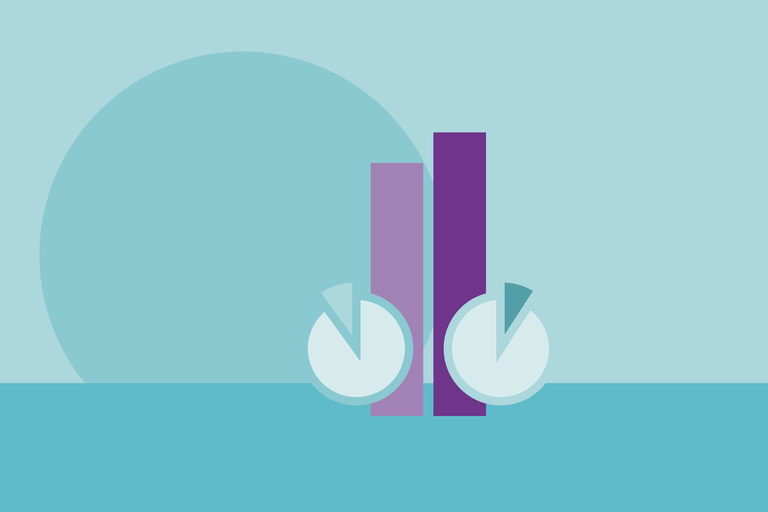Erwerbsminderung: Wenn die Kräfte nicht bis 67 reichen
Jede fünfte neu bewilligte Rente ist eine Rente wegen Erwerbsminderung. Das Antrags- und Entscheidungsverfahren ist kompliziert und für Versicherte schwer zu durchschauen. Eine Studie zeigt, was sich verbessern ließe.
Wem bereits vor Erreichen der Altersgrenze die „Kräfte und Fähigkeiten“ ausgehen, um den Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu sichern, der kann früher Rente beantragen. So steht es schon im Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz von 1889. Chronische Krankheiten oder schwere Behinderungen machen es noch heute vielen Beschäftigten unmöglich, bis zum vom Gesetzgeber vorgesehenen Regelalter durchzuhalten. Aus eigener Initiative, auf Anraten des Arbeitgebers, der Arbeitsagentur oder der Krankenkasse beantragen sie eine Erwerbsminderungsrente.
Deren Niveau ist so niedrig, dass sie oft nicht vor Armut schützt. Hier plant das Arbeitsministerium zwar Verbesserungen. Dennoch beginnt für viele mit dem Rentenantrag ein langwieriger bürokratischer und medizinischer Begutachtungsprozess – Ablehnungsbescheide, Widersprüche, neue ärztliche Untersuchungen und Klagen vor dem Sozialgericht inklusive. Der Rentenxperte Martin Brussig vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) und seine Forscherkolleginnen Patrizia Aurich-Beerheide und Manuela Schwarzkopf haben untersucht, wie sich die Übergänge in Erwerbsminderungsrente in der Praxis vollziehen. Für die von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie haben sie fast 150 Interviews mit Vertretern von Rentenversicherung, Arbeitsagenturen, Ärzten und anderen Experten in verschiedenen Regionen geführt. Ihr Fazit: Das komplizierte System von „Schleifen, Rückverweisen und Querbezügen der Sozialversicherungsträger untereinander“ lässt sich nicht ohne Weiteres durch ein einfaches, schnelleres und gerechteres ersetzen. Zu unterschiedlich sind die Einzelfälle, zu verschieden die Ziele. Beispielsweise sind Reha-Maßnahmen und die anschließende Wiederaufnahme einer Beschäftigung aus Sicht der Rentenversicherung einer vorzeitigen Verrentung stets vorzuziehen – was die Betroffenen manchmal anders sehen. Trotzdem erkennen die Wissenschaftler sozialpolitischen Handlungsbedarf: Es gelte unter anderem, die Beratung zu verbessern und die Rechte der Antragsteller zu stärken. Außerdem seien auch die grundsätzlichen Ziele der Erwerbsminderungsrente zu überdenken.
Bedeutung der Erwerbsminderungsrente nimmt zu
Mitte der 1960er-Jahre war noch mehr als jede zweite neu bewilligte Rente eine Erwerbsminderungsrente. Ihr Anteil ist bis 2006 auf 17,4 Prozent gefallen. Seitdem ist ihr Anteil wieder leicht gestiegen; aktuell ist jede fünfte bewilligte Rente eine Erwerbsminderungsrente. Dies sei auch eine Folge der Anhebung der Altersgrenzen, denn „dadurch wird aufgedeckt, dass viele nicht bis zum Erreichen einer regulären Altersgrenze arbeiten können“, schreiben die Forscher.
In den Daten spiegeln sich den Wissenschaftlern zufolge vor allem institutionelle Veränderungen: Die „Renten wegen Erwerbsminderung und Altersrenten sowie die Arbeitslosenversicherung“ bilden „ein System kommunizierender Röhren“. Je nachdem, wie sich die Zugangshürden zu den verschiedenen Leistungen verändert haben, nutzten Erwerbsgeminderte in der Vergangenheit unterschiedliche Wege zum Ausstieg aus der Arbeitswelt. In Zukunft dürfte die Bedeutung der Erwerbsminderungsrente weiter zunehmen, weil die Regelaltersgrenze steigt und Frühverrentungsmöglichkeiten „verschlossen“ sind.
Aktuell werden nur etwa 40 Prozent der beantragten Erwerbsminderungsrenten bewilligt – ein Hinweis darauf, wie schwer sich viele Betroffene tun, ihre Bewilligungschancen richtig einzuschätzen. Jede zweite Erwerbsminderungsrente ist befristet. Das heißt, die Arbeitsfähigkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut überprüft. Das durchschnittliche Zugangsalter liegt bei 52 Jahren. Die Zahl der Bewilligungen schwankt regional stark. Wo der Altersdurchschnitt der Bevölkerung hoch, die Arbeitslosigkeit ausgeprägt und die Zahl der Älteren im Job niedrig ist, bekommt ein größerer Teil der Rentenversicherten eine Erwerbsminderungsrente. Auf 1000 Versicherte kommen in Schwerin über sieben Erwerbsminderungsrenten, in Stuttgart nicht einmal drei.
Antragsverfahren müssen verbessert werden
Inwieweit wird das existierende System seinem Auftrag gerecht, Menschen mit eingeschränkter körperlicher oder psychischer Leistungsfähigkeit ein Leben ohne Erwerbsarbeit und übermäßige materielle Entbehrungen zu ermöglichen? Was passiert, wenn die Beteiligten, etwa die medizinischen Dienste der Arbeitsagenturen und der Rentenversicherung, zu verschiedenen Ergebnissen kommen? Welche Möglichkeiten haben die Antragsteller, ihre Interessen durchzusetzen und Fehlurteile von vermeintlichen Experten anzufechten? Nach genauer Durchleuchtung der Prozesse fällt das Urteil der IAQ-Wissenschaftler recht differenziert aus: „Das gegliederte System ist in rechtlicher, organisatorischer und in alltagspraktischer Hinsicht außerordentlich komplex. Es ist nicht frei von Fehlanreizen und Dysfunktionalitäten. Es wäre aber grob übertrieben, würde man das Vorgehen der Organisationen und ihr Zusammenwirken als im Grunde willkürlich charakterisieren.“ So verfolgen Arbeitsverwaltung wie Rentenversicherung vorrangig das Ziel, gesundheitlich Beeinträchtigte möglichst lange in Beschäftigung zu halten.
Vereinfachung, Vereinheitlichung, Beschleunigung der Verfahren, regelmäßige Anhörung der Betroffenen: Vieles ist verbesserungswürdig, sinnvoll und wünschenswert, so Aurich-Beerheide, Brussig und Schwarzkopf. Manches sei aber auch zweischneidig. Zwar seien lange Wartezeiten ärgerlich und aufwendige Untersuchungen teuer, aber Zeit- und Kostendruck würden am Ende die Qualität der Gutachten verschlechtern. Auch die Frage, ob besser externe oder interne medizinische Gutachter zum Einsatz kommen sollten, lasse sich nicht eindeutig beantworten. Bei der Rentenversicherung angestellte Ärzte dürften weniger Kommunikationsprobleme mit der Verwaltungsebene haben, sie können aber nicht gleichzeitig Spezialisten für sämtliche Krankheiten sein. Meinungsverschiedenheiten und mit ihnen die im aktuellen System vorgesehenen Schlichtungs- und Widerspruchsprozesse seien unvermeidlich. Selbst für die von den Autoren eher kritisch gesehene Praxis der Entscheidung auf Aktenbasis, also ohne Anhörung der Person, findet sich in der Studie noch ein Argument: Wenn der Fall hinreichend klar sei, könne man den Betroffenen das Vorsprechen ersparen.
Dennoch listen die IAQ-Forscher einige verbesserungswürdige Punkte auf:
- Die Beratung muss besser werden. Vielen Versicherten seien die Abläufe nicht klar und „aufgrund von Unkenntnis riskieren sie, ihre Rechte nicht vollumfänglich wahrzunehmen“.
- Situationen seien zu vermeiden, in denen die Antragsteller sich „schizophren anmutenden Anforderungen“ ausgesetzt sehen. Das ist etwa dann der Fall, wenn sie gleichzeitig der Ablehnung ihres Antrags auf Erwerbsminderung widersprechen, sich aber der Arbeitsagentur gegenüber als vermittlungsfähig präsentieren müssen, um weiter Leistungen zu erhalten.
- Fortbildung und Aufbau von „Wissenspools“ seien gerade in den Jobcentern nötig, damit Vermittlungsfachkräfte auch mit seltenen Fallkonstellationen besser umgehen können.
- Kommunikationsbarrieren zwischen Fachdisziplinen – Medizin und Verwaltungslogik – könnten durch mehr Austausch und „professionsübergreifende Fallkonferenzen“ abgebaut werden.
- Versicherte sollten grundsätzlich ein Anrecht bekommen, ihren Fall der zuständigen Stelle persönlich vorzutragen.
- Wenn die vorzeitige Verrentung nach Möglichkeit vermieden werden soll, muss gesundheitlich eingeschränkten Menschen ernsthafte Unterstützung bei der angestrebten Arbeitsmarktintegration angeboten werden, was heute kaum geschieht. Vermutlich, so die Forscher, sei dazu mehr öffentliche Beschäftigung nötig.
- Beziehern von befristeten Erwerbsminderungsrenten sollte es leichter gemacht werden, zumindest testweise ins Erwerbsleben zurückzukehren, ohne dass sie ihren einmal erstrittenen Anspruch verlieren. Im Übrigen sei es nicht glücklich, zeitlich beschränkte Leistungen „Rente“ zu nennen, weil die Bezieher mit dem Begriff den endgültigen Abschied aus der Arbeitswelt assoziierten.
Schließlich stellen Aurich-Beerheide, Brussig und Schwarzkopf die Frage, ob man die Definition von Erwerbsunfähigkeit nicht weiter fassen sollte. Würden der erlernte Beruf und der potenziell zu erzielende Lohn wieder eine Rolle spielen, würde die Erwerbsminderungsrente „frühere Investitionen in die Qualifikation“ versichern und ihre Schutzfunktion besser erfüllen. Ziel sollte sein, „die Erwerbsminderungsrente zu einem armutsfesten und zielgenauen Element im System der sozialen Sicherung zu entwickeln“. Zudem sollte angestrebt werden, „den Eintritt einer Erwerbsminderung zu vermeiden und eine Erwerbsteilhabe trotz eingeschränkter Erwerbsfähigkeit zu ermöglichen“.
Im Jahr 2001 wurde die Erwerbsminderungsrente grundlegend reformiert. Seitdem ist für die Beurteilung der Erwerbsfähigkeit nur noch relevant, ob jemand in der Lage ist, eine gewisse Stundenzahl in irgendeinem Job zu arbeiten. Wer nicht mehr als drei Stunden schafft, gilt als voll erwerbsgemindert, wer höchstens sechs Stunden schafft, kann eine teilweise Erwerbsminderung geltend machen. Erworbene Qualifikationen, frühere Tätigkeiten und das bisherige Verdienstniveau spielen keine Rolle. Die Bedingungen haben sich aus Sicht der Versicherten deutlich verschlechtert, erklären die IAQ-Forscher, „denn gesundheitliche Einschränkungen, die zwar keine Vollzeitarbeit, aber eben mindestens sechs Stunden am Tag erlauben, sind ebenso wenig abgesichert wie Verdienstrückgänge aufgrund gesundheitlich erzwungener Jobwechsel.“ Unverändert blieb die versicherungsrechtliche Voraussetzung, in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre versicherungspflichtig erwerbstätig gewesen zu sein.
Patrizia Aurich-Beerheide, Martin Brussig und Manuela Schwarzkopf: Zugangssteuerung in Erwerbsminderungsrenten (pdf), Study der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung Nr. 377, August 2018