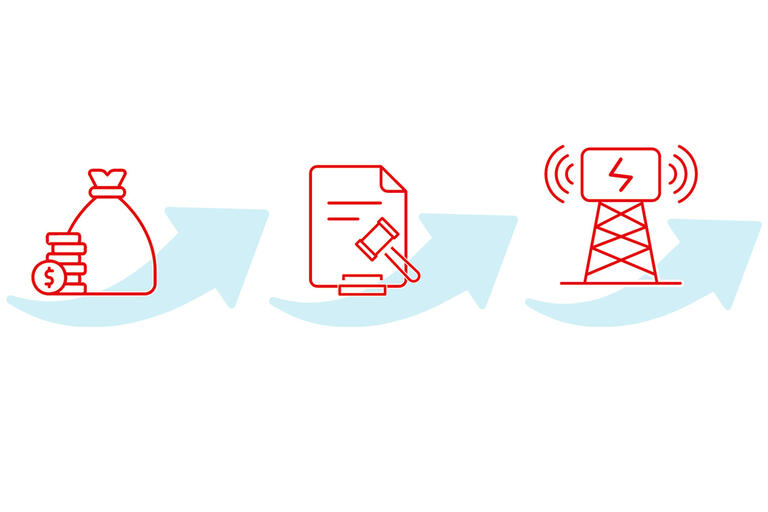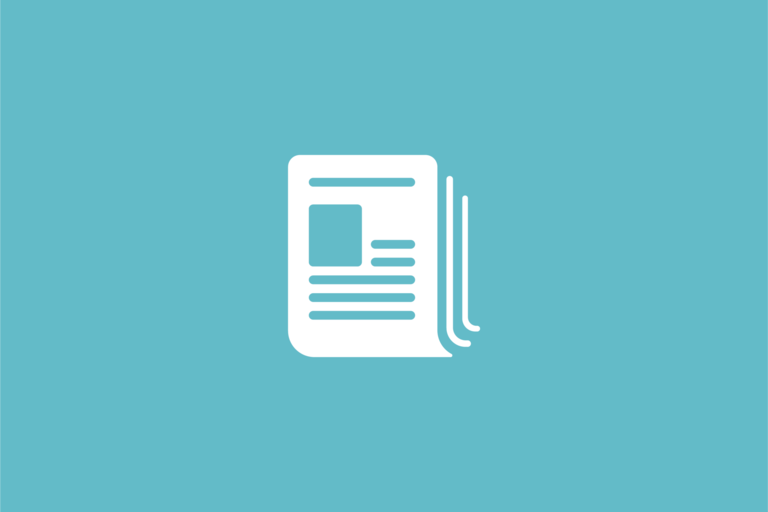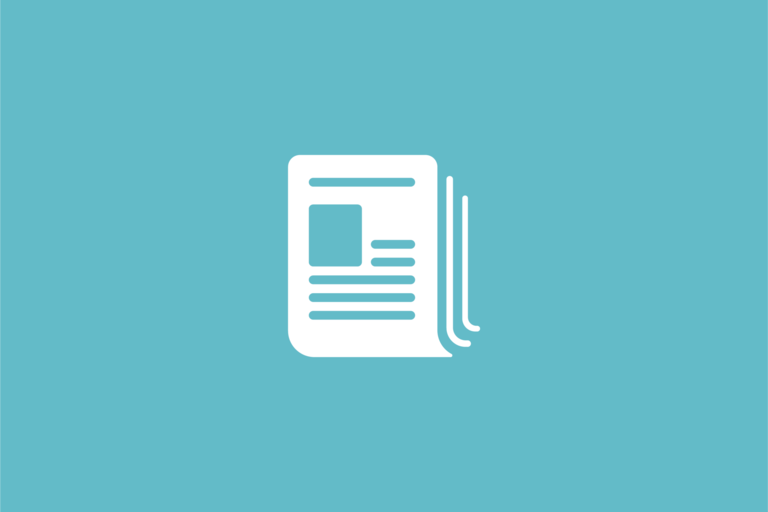: INTERVIEW „Die Finanzindustrie hat die Politik in die Detailfalle gelockt“
Thierry Philipponnat, Chef der Gegenlobby-Organisation Finance Watch, über die mächtige Finanzindustrie, überforderte Parlamentarier und warum manchmal fünf Seiten mehr sind als 750
Mit Thierry Philipponnat sprachen INGMAR HÖHMANN und MARGARETE HASEL in Brüssel./Foto: Juha Roininen
Sie treten in Brüssel gegen die Finanzlobby an – David gegen Goliath. Das Bild gefällt Ihnen, haben Sie erklärt. Weil sich David durchsetzt. Sind Sie ein unverbesserlicher Optimist?
Auf den ersten Blick ist das Verhältnis tatsächlich unausgeglichen. Finance Watch hat derzeit zehn Mitarbeiter. Die Finanzindustrie beschäftigt 700 Lobbyisten in Brüssel. Doch unsere Mitgliedsorganisationen vertreten fast 100 Millionen europäische Bürger. In einer Demokratie ist das viel wert. Die Kombination aus gesellschaftlicher Repräsentation und professioneller Expertise ist eine Mischung, die in Brüssel gut ankommt.
Waren die Politiker den Lobbyisten der Finanzindustrie bislang hilflos ausgeliefert?
Die Gründungsgeschichte von Finance Watch spricht für sich. Normalerweise wird eine NGO gegründet, weil Leute eine Idee vorantreiben und sich bei Politikern Gehör verschaffen wollen. Bei Finance Watch war es umgekehrt: Abgeordnete des Europaparlaments haben im Sommer 2010 einen Aufruf veröffentlicht: „Bitte macht Lobbyarbeit“, flehten sie, „wir brauchen euren Rat.“ Dass die Initiative von der Politik kam, hilft uns enorm.
Die Kluft zwischen den Möglichkeiten der Finanzindustrie und dem fehlenden Sachverstand auf der politischen Seite gefährde die Demokratie, schrieben die Parlamentarier in diesem Aufruf.
Die Finanzindustrie hat es geschafft, dass in den westlichen Demokratien zunehmend privatwirtschaftliche und öffentliche Interessen gleichgesetzt werden. Sobald ein Akteur der Branche für etwas zahlen soll, behauptet er, das sei auch schlecht für die Gesellschaft. Doch das ist falsch: Öffentliches Interesse ist nicht einfach die Summe privater Interessen. Aber solche Argumente machen deutlich, wie stark die Finanzindustrie auf die Politik einwirkt.
Ist es wirklich so dramatisch?
Die gute Nachricht ist: Finance Watch zeigt, dass in Europa immer noch eine wache politische Welt existiert. Mehr als 200 gewählte Volksvertreter mit ganz unterschiedlichem parteipolitischem Hintergrund haben den Aufruf unterschrieben. Die Abgeordneten sind sich sehr bewusst, dass sie das öffentliche Interesse vertreten.
Die Finanzmarktregulierung ist bisher kaum vorangekommen. Dabei sind sich seit Ausbruch der Finanzkrise die Regierungen in Berlin, Paris und Brüssel, sogar in London und Washington einig über den Handlungsbedarf.
Das hat viele Gründe. Zum einen ist der Gegenstand sehr umfassend. Zum anderen bleiben Reformvorhaben immer wieder an Details hängen – die zwar wichtig sind, aber nicht ausschlaggebend. Jedes Detail nimmt sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre in Anspruch. Währenddessen bleiben die fundamentalen Probleme ungelöst. Die Lobbyisten der Finanzinstitute verwenden viel Energie darauf, die Gesetzgeber systematisch in Details zu ertränken. Darum reagieren wir auf Gesetzesentwürfe. Aber das reicht nicht.
Wie gehen Sie beim Lobbying vor?
Wir wollen Expertise and Analysen produzieren und veröffentlichen. Aber Lobbying besteht vor allem darin, mit Politikern zu reden. So habe ich bei einer Sitzung im Europäischen Parlament über das Regulierungspaket CRD IV, mit dem die Basel-III-Standards in europäisches Gesetz umgesetzt werden, zweieinhalb Stunden meinen Standpunkt vertreten. Wir treffen uns mit Parlamentariern, wir sprechen mit der Kommission. Wir wissen, wer die wichtigen Leute in Brüssel sind. Wir gehen auf diejenigen zu, die Entscheidungen fällen und Kompromisse aushandeln.
Geschieht das auch informell – bei einem gepflegten Abendessen?
Auch das kommt vor. Aber informell heißt für uns nicht intransparent. Wir sind als Lobbyorganisation registriert. Alles, was wir tun, ist öffentlich. Es gibt zwei Konzepte von Lobbying: Das erste besteht darin, auf Leute zuzugehen und offen seine Überzeugung zu vertreten. Beim anderen geht man zusammen etwas trinken, baut Freundschaften auf, um dann einen Gefallen zu verlangen. Das sind nicht wir.
Die Finanzindustrie verfolgt das zweite Konzept?
Das nehme ich an, ja. Lobbying hat viele Ausprägungen. Manche sind legitim, andere nicht – vor allem, wenn sie im Verborgenen geschehen.
Ein wenig mehr Transparenz würde auch den Texten zur Finanzmarktregulierung guttun – sie sind sehr technisch und kompliziert. Wie soll ein normaler Abgeordneter da durchblicken?
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute denken, dass das Thema Finanzen schwierig ist. Aber wissen Sie was? Die Finanzwirtschaft ist gar nicht kompliziert. Die Grundlagen sind sogar sehr einfach zu verstehen, das ist Teil unserer Botschaft.
Die CRD-IV-Regulierung umfasst 750 Seiten voller mathematischer Formeln, und das ist nur ein kleiner Teil. Das soll nicht kompliziert sein?
Sie haben recht, die Richtlinie ist nicht einfach. Das ist eines der Beispiele, wo die Finanzindustrie den Gesetzgeber in die Detailfalle gelockt hat – mit dem Ziel, dass möglichst wenig passiert. Ein Gesetzentwurf, der sich auf 80 Seiten mit Kreditrisikominderungstechniken auseinandersetzt und auf 20 Seiten Differentialgleichungen präsentiert, macht keinen Sinn. Unser Argument: Lasst uns über die grundlegenden Parameter und über Inhalte reden, die Regulierungsbehörden auch umsetzen und Volksvertreter verstehen können. Viel besser wäre es, erst einmal den Eigenkapitalanteil zu regulieren, der in der Bilanz steht. Dafür brauchen wir nur fünf anstelle von 750 Seiten.
Wenn das alles so einfach ist: Worum geht es beispielsweise bei CRD IV?
Die Banken sagen, es sei nicht ihr Fehler, dass sie immer wieder vor der Pleite stehen, sondern die Krise sei schuld. Vor vier Jahren war es die Subprime-Krise, heute ist es die Eurokrise, demnächst wird es etwas anderes sein. Ich meine: Dass es Krisen gibt, sollte einen Banker nicht überraschen. Wer den Atlantik überqueren will, braucht ein Schiff, das nicht im ersten Sturm untergeht. Denn irgendwann wird der Sturm kommen. Da kann man nicht mit einem klapprigen Segelboot lossegeln und die Schuld auf das Unwetter schieben, wenn das Boot sinkt. Wir brauchen wetterfeste Banken, die nicht immer wieder vom Steuerzahler gerettet werden müssen, sobald die Wirtschaft in eine Krise gerät.
Wirft Ihnen die Bankenlobby nicht vor, allzu simpel an die Probleme heranzugehen, wenn Sie so reden?
Wir wissen, dass wir auf mehreren Ebenen kommunizieren müssen. Wir richten uns auch an die Finanzindustrie selbst und zeigen, dass wir auf Augenhöhe reden können. Im Juli haben wir ein Papier zu Kreditausfallversicherungen, den Credit Default Swaps (CDS) veröffentlicht. Wir haben acht Seiten dazu geschrieben, die wir mit Absicht sehr technisch gehalten haben. Dabei haben wir ein Argument der Branche entlarvt. Die Banken haben gesagt, dass die Spekulation mit CDS die Finanzierungskosten von Staatsschulden verringert. Wir haben nachgewiesen, dass das rein technisch gar nicht möglich ist.
Als der zuständige EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier vor Kurzem das Verbot von CDS-Leerverkäufen ankündigte, hat er das damit begründet, dass CDS die Krise zwar nicht ausgelöst, aber verschlimmert hätten. Das stand Wort für Wort so in Ihrem Papier. Hat er abgeschrieben?
Da müssen Sie ihn selbst fragen. Ich weiß, was wir geschrieben haben, ich weiß, was er gesagt hat. Wenn man beides vergleicht, dann ist es ziemlich ähnlich.
Sie nutzen die Einblicke, die Sie in Ihrem Job als Investmentbanker gewonnen haben. Sind Sie in den Augen Ihrer früheren Kollegen ein Verräter?
Ein paar sehen das vielleicht so, aber das sind Ausnahmen. Die Banken als Institutionen vertreten natürlich ihre Interessen. Aber wenn ich privat mit den Leuten rede, geben die meisten zu, dass es da ein paar Probleme mit dem Einfluss der Finanzindustrie auf die Politik gibt.
Ihre Wandlung vom Saulus zum Paulus, um ein weiteres biblisches Bild zu bemühen, geschah spät.
Als ich 1985 angefangen habe, sah die Finanzwelt anders aus. Doch dann gab es eine starke Entwicklung hin zu immer komplizierteren Transaktionen, die kaum noch Verbindung mit der realen Welt haben.
Wann haben Sie sich entschlossen, die Seiten zu wechseln?
Zuletzt habe ich die Abteilung Aktienderivate bei Euronext Liffe geleitet, eine der größten Derivatebörsen der Welt. Es war meine Aufgabe, mehr Aktienderivate zu entwickeln und zu verkaufen. Wie bei allen Unternehmen ging es darum, Marktanteil, Umsatz und Gewinn zu steigern. Das war vollkommen legal. Aber dann habe ich mich gefragt: Will ich wirklich, dass Kleinanleger wie Herr Dupont oder Frau Maier in der nächsten Woche mit Aktienoptionen auf den Kurs von Volkswagen oder Peugeot spekulieren? Um solche Wetten geht es bei Aktienderivaten. Ich kam zu dem Ergebnis, dass die Gesellschaft das nicht braucht. Das ist im besten Fall nutzlos, im schlechtesten Fall schädlich. So habe ich beschlossen, etwas zu machen, das der Gesellschaft mehr hilft.
Ähnliche Beweggründe hat die Occupy-Wall-Street-Bewegung. Wie hilfreich ist die Unterstützung durch die Straße?
Wenn ich höre, wie die Finanzindustrie argumentiert, fühle ich mich genötigt, die angeblichen Zusammenhänge zu widerlegen. Wer kein Finanzexperte ist, kann es vielleicht nicht widerlegen, aber er kann es fühlen. Bei Occupy Wall Street geht es genau darum. Ganz normale Bürger sagen: Wir haben genug! Manchmal sind die Forderungen technisch nicht ganz richtig formuliert. Aber die Bewegung reflektiert etwas sehr Fundamentales: einen Trend in der Gesellschaft, sich gegen Missstände zu organisieren. Aus dieser Quelle ist auch Finance Watch entstanden.
Auch die Mitglieder von Finance Watch sind alles andere als einheitlich. Was haben Gewerkschaften, Verbraucherschützer und Kleinanleger gemeinsam?
Die Unterschiede sind tatsächlich groß. Es war für mich eine unglaubliche Erfahrung, das bei der Gründung mitzuerleben: Manche könnten als Banker durchgehen und tragen Nadelstreifenanzug und Krawatte. Andere sehen wie militante NGO-Aktivisten aus. Wieder andere sind Wissenschaftler. Doch alle Mitglieder haben eines gemeinsam: Sie sind überzeugt, dass die Finanzwelt der Gesellschaft dienen muss – und nicht umgekehrt.
Dennoch: Sind da nicht Interessenkonflikte vorprogrammiert?
Wenn wir für jede Äußerung erst einen Konsens herstellen müssten, kämen wir zu nichts. Wir brauchen eine Balance zwischen dem Dialog mit den Mitgliedern und der Möglichkeit, Position zu beziehen. Dafür haben wir eine Lösung gefunden: Wir beraten die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, mit unseren Mitgliedern. Die letzte Entscheidung aber unterliegt der Verantwortung des Teams, geführt vom Generalsekretär, also mir.
Machen wir das mal praktisch: Wo würden Sie ansetzen, wenn Sie die Chance hätten, eine nachhaltige Finanzwirtschaft zu gestalten?
Zunächst würde ich die Aktivitäten der Finanzindustrie trennen: Kreditvergabe an die Realwirtschaft – und Spekulation, also Wetten auf künftige Ereignisse, die der Gesellschaft nicht nützen. Der Staat sollte nur Kreditinstitute unterstützen, die ausschließlich die Realwirtschaft finanzieren. Eine Bank kann gerne spekulieren, dann aber bitte auf eigene Kosten und ohne staatliches Geld. Zweitens: Jeder sollte den Unterschied zwischen Investition und Spekulation begreifen. Derzeit gibt es eine Diskussion darüber, ob Rohstoffinvestments gut oder schlecht sind. Das ist absurd: Es gibt keine Finanzinvestments in Rohstoffe, das sind Wetten, die da abgeschlossen werden.
Es geht nicht um Rohöl, Eisen, Weizen oder Schweinehälften?
Da liegt ein grundsätzliches Missverständnis vor. Ein Beispiel: Nächstes Jahr wird das Parlament über die sogenannte PRIP-Richtlinie diskutieren. Dabei handelt es sich um Finanzprodukte, die Kleinanleger kaufen können, um zu spekulieren – also um Wett-Produkte. Doch die Kommission nennt das vornehm „Packaged Retail Investment Products“. Wenn wir den Mann auf der Straße dazu anhalten, darauf zu wetten, dass der Aktienmarkt abstürzt, haben wir die Verbindung zwischen Finanzwirtschaft und Gesellschaft zerschnitten. Die Gesellschaft braucht keine Wetten. Doch die Politik hat den Unterschied zwischen Investition und Spekulation offenbar immer noch nicht begriffen.
Zur Person
Thierry Philipponnat, 49, leitet seit Dezember 2010 das Finance-Watch-Projekt in Brüssel; Ende Juni 2011 wurde der Franzose für fünf Jahre zum Generalsekretär bestellt. Davor hatte der Volkswirt über 20 Jahre in der Finanzindustrie Karriere gemacht. Stationen waren die Schweizer UBS und die französische BNP Paribas, wo er im Investmentbanking für strukturierte Finanzgeschäfte verantwortlich war – jene komplizierten Produkte, die jetzt als hochriskant in der Kritik stehen. Zuletzt war er im Vorstand der Derivatebörse Euronext Liffe in London zuständig für den Handel mit Terminkontrakten und Derivaten. 2006 verließ er den Bankensektor, um für Amnesty International zu arbeiten.